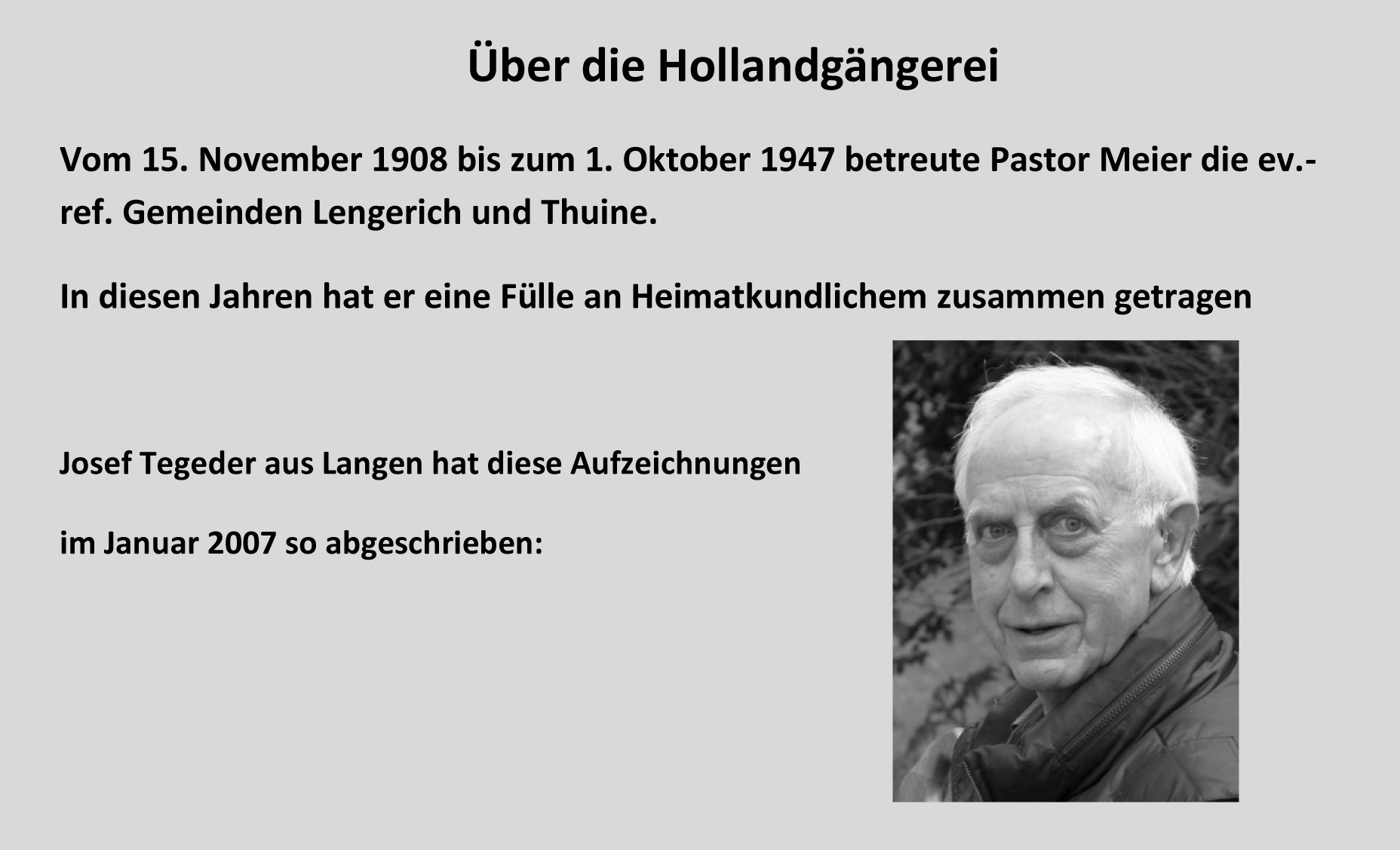„Tagelang war die Reise schon vorbereitet worden.
Was war da nicht alles in dem großen Reisesack verstaut, der meistens das Durchschnittsgewicht von 50 Pfund hatte. Leibwäsche, Arbeitsanzug und eine gehörige Portion Lebensmittel, denn ein großer Teil der Hollandgänger, die Torfarbeiter alle, musste sich selbst beköstigen und nahm sich für die ersten sechs Wochen (5 bis 6 Tage dauerte die Hinreise) fast alles mit. (…)
Anfangs musste der schwere weißgraue Leinensack getragen werden. Vater, Mutter, die Braut begleiteten den Mann bis an die Gemeindegrenze, so dass bei einem solch traurigen Ausgang, wo es oft viele Tränen gab, oftmals das halbe Dorf auf den Beinen war.
An der Gemeindegrenze blieben dann die Angehörigen zurück.
Nach und nach schlossen sich dann ebenfalls wandernde Arbeitskameraden aus Nachbarbezirken an. Einer ging mit der Harmonika (plattdeutsch: Handörgel) oder einer „Schalmei“, einem der Klarinette ähnelnden Instrument, vorauf, während die anderen zum Zeitvertreib dazu sangen.
Die Sense war auseinander genommen und wurde erst an Ort und Stelle auf einen Stiel, den man für wenig Geld bekommen konnte, gesteckt. Oder man erwarb sich in einer der zahlreichen „Sensenschmieden“, die an dem altbekannten Reiseweg lagen, eine solche. Denn die Hollandgänger schlugen Jahr für Jahr die gleichen Reisewege, die schon die Großväter gegangen waren, ein. Es gab Sensenschmieden, die ausschließlich nur für die Hollandgänger arbeiteten.
http://www.heuerleute.de/pastor-meier-erzaehlt/
Die Pflege von Kranken und sonstigen Hilfsbedürftigen war früher im allgemeinen die Aufgabe der Kirchen, der kirchlichen Einrichtungen und der Klöster. Viele aus unserer Heimat werden sich wegen Hilfe daher an die Zisterzienserinnen des Klosters Börstel gewandt haben. In den Familien kannte man sich zudem mit den Heilkünsten der Natur recht gut aus. Viele Kranke suchten auch Heilung bei einem der Schäfer in unserer Umgebung.
Bei Erkältungskrankheiten im Winter wirken bekanntlich Naturheilkräuter zum Inhalieren. Altbürgermeister Josef Triphaus, Grafeld,erklärte z.B., daß man zum „Rökern“ früher Feldsteine im Kamin erhitzt habe, die man dann in einen Behälter mit Heusamen und Wasser gab. Der Brei begann sofort zu brodeln und zu dampfen. Jetzt setzte man sich auf die Bettkante, nahm das Gefäß zwischen die Füße und inhalierte. Dasselbe machte man mit getrockneten Fliederbeeren, mit trockener Kamille und auch Heu, bestehend aus bestimmten Grassorten.
In den Dörfern gab es Leute mit ärztlicher Vorbildung erst spät und dann auch nur relativ selten. So wissen wir, daß in Berge 1667 ein Fachkundiger namens Feldscher erwähnt wird, der seine Kenntnisse während seiner Kriegsdienste erworben hatte. Um 1740 und im Jahre 1772 ist von einem Chirurgen C.H. Meyding in Berge-Schmone die Rede. Die weitere Aufzählung der Ersterwähnungen soll mit dem Chirurgen Wilhelm Dipenbeck (1803), der sich auch in der Geburtshilfe auskannte, und dem Arzt C. Ey-mann (1806) hier schließen‘.
Die Pflege von Kranken und sonstigen Hilfsbedürftigen war früher im allgemeinen die Aufgabe der Kirchen, der kirchlichen Einrichtungen und der Klöster. Viele aus unserer Heimat werden sich wegen Hilfe daher an die Zisterzienserinnen des Klosters Börstel gewandt haben. In den Familien kannte man sich zudem mit den Heilkünsten der Natur recht gut aus. Viele Kranke suchten auch Heilung bei einem der Schäfer in unserer Umgebung.
Bei Erkältungskrankheiten im Winter wirken bekanntlich Naturheilkräuter zum Inhalieren. Altbürgermeister Josef Triphaus, Grafeld,erklärte z.B., daß man zum „Rökern“ früher Feldsteine im Kamin erhitzt habe, die man dann in einen Behälter mit Heusamen und Wasser gab. Der Brei begann sofort zu brodeln und zu dampfen. Jetzt setzte man sich auf die Bettkante, nahm das Gefäß zwischen die Füße und inhalierte. Dasselbe machte man mit getrockneten Fliederbeeren, mit trockener Kamille und auch Heu, bestehend aus bestimmten Grassorten.
In den Dörfern gab es Leute mit ärztlicher Vorbildung erst spät und dann auch nur relativ selten. So wissen wir, daß in Berge 1667 ein Fachkundiger namens Feldscher erwähnt wird, der seine Kenntnisse während seiner Kriegsdienste erworben hatte. Um 1740 und im Jahre 1772 ist von einem Chirurgen C.H. Meyding in Berge-Schmone die Rede. Die weitere Aufzählung der Ersterwähnungen soll mit dem Chirurgen Wilhelm Dipenbeck (1803), der sich auch in der Geburtshilfe auskannte, und dem Arzt C. Ey-mann (1806) hier schließen‘.
Daß es in Anten vor 200 Jahren eine Heilkundige gab, war bisher nicht bekannt. Früher wurden solche Leute auch als „Quacksalber“ bezeichnet, die Heilversuche ohne wissenschaftlich-medizinische Ausbildung vornahmen.
Die Heilkundige aus Anten stellte die Rezepte selbst zusammen und probierte sie an ihren Patienten aus. Frau Anneliese Tepe, Bippen, besitzt noch ein altes Anschreibebuch aus dem elterlichen Haus in Anten (heute Pächter Willi Tiemann), das sie zur Auswertung zur Verfügung stellte. Das Bauernhaus Tepe wurde 1967 umgebaut. Anneliese Tepe erinnert sich jedoch noch heute der verdeckten Inschrift über dem Torbogen:
Thole-Huflage genannt Tepen Eheleute
anno 1739
aus: Udo Hafferkamp, Beiträge zut Heimatgeschichte Berge 1996, Seite 43 – 47
EINE „STRASSE“ AM NORDSÜDKANAL
Eine bekannte holländische Tageszeitung hat einmal — und zwar vom holländischen Standpunkt mit Recht — geschrieben, Deutschland beginne dort, wo die Kultur aufhöre. Während an den Kanälen, die Holland durch Heide und Moor gegraben hat, saubere und breite Straßen laufen, die mit Klinkersteinen gepflastert sind oder mit Asphalt gedeckt, sinken auf den meisten Straßen, die sich längs der deutschen Kanäle erstrecken, Fuß und Rad in Schmutz und Sumpf. Während an den holländischen Kanälen vorbildliche Siedlungsarbeit sowie gewinnbringende und im wahrsten Sinne volkswirtschaftliche Bodenkultur geleistet wird, herrscht auf deutscher Seite volkswirtschaftswidriges Bauernelend und Heuerlingselend. Im Emsland gibt es noch heute 112 Gemeinden oder größere Ortsteile, die keine festen Straßen haben, sondern nur auf grundlosen Sandwegen zu erreichen sind.
im Vergleich zu:
EINE HOLLÄNDISCHE KANALSTRASSE ZWEITER ORDNUNG
So sieht eine holländische Straße zweiter Ordnung aus, die an der Seite einer Wasserstraße nahe der deutschen Grenze entlangführt. Die Straßen erster Ordnung sind derart, daß wir ähnliches in weiten Strecken des Deutschen Reiches nicht besitzen. Die Erklärung für diesen Gegensatz liefert nicht der verlorene Krieg, weil auf diesem Gebiete schon weit vor dem Kriege unendlich viel zum Schaden der deutschen Volkswirtschaft versäumt worden ist. Es fehlte an Erkenntnis für den Wert der inneren Kolonisation im Zusammenhang mit der notwendigen Rücksichtnahme auf Bevölkerungspolitik,Handelsbilanz und Zahlungsbilanz. Denn in Gebieten, die zum Nutzen des Volksganzen kultiviert und besiedelt werden, ist die Straße alles, und zwar in gleicher Weise die Wasserstraße wie die Landstraße, abgesehen von den Eisenbahnverbindungen. Erst müssen Verkehrsmöglichkeiten geschaffen werden, ehe eine volkswirtschaftlich ertragreiche Siedlung gedeihen kann. Nur dort, wo durch die Verkehrsmöglichkeit die Weiterbeförderung landwirtschaftlicher und industrieller Erzeugnisse zu den Absatzmärkten gesichert ist, gedeiht die Siedlerarbeit und bietet Anreiz zu weiteren Siedelungen. Der einsame Moorsiedler oder Heidebauer, dem kein Verkehrsweg zu den Absatzmärkten zur Verfügung steht, leistet unproduktive Arbeit, wenn er mehr als das produziert, was er zu seinem eigenen Unterhalt benötigt.
Das Emsland umfaßt heute an Odlandgebieten, die ihrer gewinnreichen Erschließung harren, noch über 150000 ha unkultivierte Heide und Moor= 38,9% der Gesamtfläche. Die Ertragsfähigkeit dieses Gebietes nach seiner Kultivierung ist bereits, nämlich durch die holländische Arbeit, bewiesen; denn durch das Bourtanger Moor, das sich von Deutschland bis tief hinein ins holländische Gebiet erstreckt, läuft völlig unorganisch, als wäre sie mit dem Lineal gezogen, die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Es waren auch keineswegs Deutsche, sondern Holländer, die auf der deutschen Seite des Bourtanger Moores mit einer wirklichen Torfindustrie begannen. Der Grundsatz dieser Industrie lautet: Maschinell, sauber, eilig, ertragreich!
Über sechs Jahrzehnte nach jenem Bericht der Osnabrücker Handelskammer ist das holländische Vorbild, auf das diese Kammer verwies, im Emslande fast noch genau so unerreicht wie damals. Ein Menschenalter ist vergangen ohne wesentliche Fortschritte in der emsländischen Bodenkultur und seiner inneren Kolonisation, weil der kühne Unternehmergeist, der auch die Mittel zu schaffen weiß, mitsamt der Kraft und Raschheit in der Ausführung, die von der Osnabrücker Handelskammer bei der holländischen Arbeit mit Recht bewundert wurden, auf deutscher Seite bisher gefehlt hat. Da kann für Deutschland, für Preußen, für die Provinz Hannover nur ein Gebot gelten: An die Arbeit!
Erst um das Jahr 1870 hat man damit begonnen, die Hochmoore des Emslandes planmäßig zu kanalisieren. „Wir wissen sehr wohl,“ so schreibt im Jahre 1874 die Osnabrücker Handelskammer in ihrem Jahresbericht, daß die Hohe Staatsregierung, die sich durch die Ausführung der Kanalisierung ein nicht hoch ‚genug anzuerkennendes Verdienst erwirbt, an manche Rücksichten, namentlich an die etatsmäßigen Mittel gebunden ist . . . . Allein andererseits glauben wir auch, daß Deutschland in Betreff solcher Bauten die Niederlande zum Vorbild nehmen könnte, wo nicht nur ein kühner Unternehmungsgeist die Pläne entwirft und die Mittel zu schaffen weiß, sondern wo sich auch demselben eine Kraft und Raschheit in der Ausführung zugesellt, die mit gerechter Bewunderung zu erfüllen geeignet ist.“
Das emsländischeGesamtgebiet, das die Kreise Aschendorf,Hümmling, Meppen, Lingen und Bentheim umfaßt, erstreckt sich über 392000 ha und hat trotz der grösseren Städte und Ortschaften, in denen sich zum Teil ein sehr reges Wirtschaftsleben entwickelt hat, nur eine Gesamtbevölkerung von 171 000 Einwohnern. Danach beträgt die Bevölkerungsdichte im Durchschnitt 43,61 Einwohner auf 1 qkm gegenüber durchschnittlich 69,18 im Regierungsbezirk Osnabrück, zu dem das Emsland gehört, und 133,1 im Reich. Der Kreis Hümmling ist mit der Zahl 26,39 der geringst besiedelte Kreis in Preußen. Dagegen beträgt die Vergleichsziffer im holländischen Grenzgebiet 80 Einwohner pro qkm.
Unabsehbar und wegelos lagen noch vor wenigen Menschenaltern die weiten Moorstrecken und Heideflächen des deutschen Emslandes vor den Augen der einsamen Heidebauern und der wenigen Wanderer, die es wagten, den Fuß auf trügerischen Boden zu setzen. Aber noch heute sind unübersehbare Strecken dieses Gebietes unentdecktes deutsches Land, sind Raum ohne Volk im Reiche eines Volkes, das sich Volk ohne Raum nennt, das nach Kolonien verlangt, aber den Wert der inneren Kolonisation noch nicht so erkannt hat, wie Gegenwart und Zukunft es erfordern, und das in seinen jugendlichen Erwerbslosen sicherlich freiwillige Mitarbeiter für diesen kolonisatorischen Dienst zur Verfügung stellen könnte.