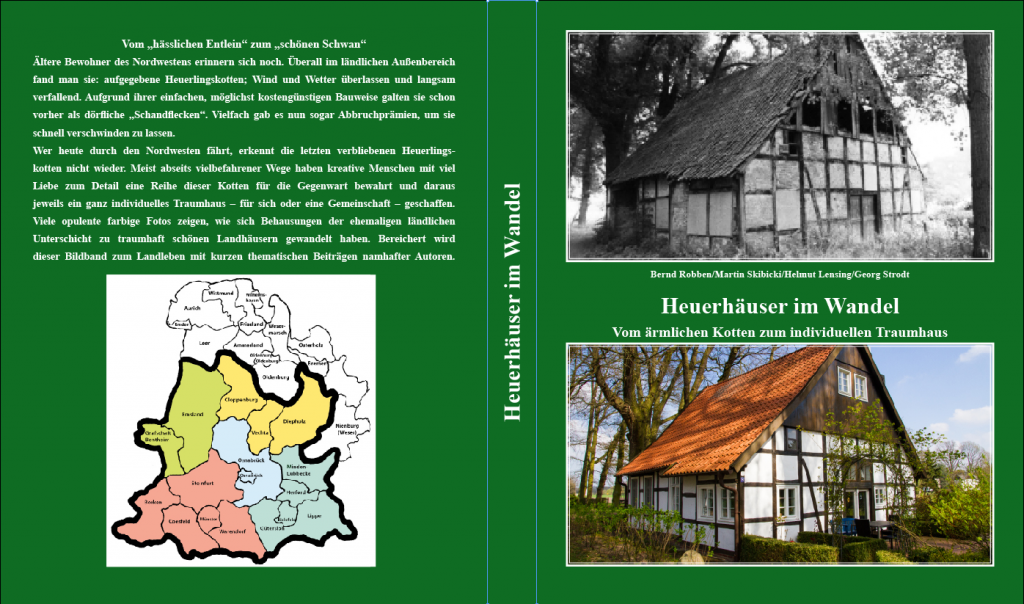Christiane Cantauw studierte Neuere Geschichte, Volkskunde und Ethnologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nach ihrem Volontariat wurde sie als wissenschaftliche Referentin bei der Volkskundlichen Kommission tätig und leitet diese seit 2005 als wissenschaftliche Geschäftsführerin. Unter anderem verantwortete sie hier ab 1997 ein von der VW-Stiftung gefördertes Vorhaben zur Digitalisierung des Bildarchivs. Im Rahmen eines durch die DFG geförderten Projekts konnte sie zwischen 2006 und 2012 das digitale Archiv der Volkskundlichen Kommission weiter ausbauen. Christiane Cantauw hat zu Themen wie Brauchkultur, Freizeit und Tourismus geforscht und veröffentlicht. Neben ihrer Tätigkeit in der Volkskundlichen Kommission übernimmt sie regelmäßig Lehraufträge am Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie der WWU Münster.
Leben und Alltag von Heuerlingsfrauen und -mädchen im 19. Jahrhundert
von Christiane Cantauw
Leben und Alltag von Heuerlingsfrauen im 19. Jahrhundert darzustellen, erweist sich als einigermaßen schwierig, standen Frauen doch selten einmal im Fokus sozial- oder wirtschaftshistorischer Beschreibungen. Entsprechend wenige Quellen liegen über ihr Leben und ihren Alltag vor. In der Regel waren es die Männer, allenfalls die Familien als Ganzes, über deren soziale oder wirtschaftliche Lage in den aufklärerischen oder sozialreformerischen Schriften raisonniert wurde.
Frauen, das betraf nicht nur diejenigen aus den unteren sozialen Schichten, waren in der patriarchalisch geprägten Gesellschaft des 19. Jahrhunderts in allen Belangen dem Mann nachgeordnet. Diese Stellung war nicht zuletzt rechtlich fixiert, so dass Frauen – unabhängig davon, ob sie nun verheiratet waren oder nicht – der ihnen seitens der Gesellschaft zugewiesenen passiven Rolle nur schwerlich entkommen konnten.
Waren die Heuerlinge – je nach dem (meist mündlich verabredeten) Pachtvertrag, den sie mit dem Colon abgeschlossen hatten, und je nach den zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten durch Spinnen, Weben, Zi-garrenmachen, Hollandgängerei etc. – in mehr oder weniger hohem Maße abhängig von den Besitzenden, so galt diese Abhängigkeit umso mehr für ihre Frauen und Töchter, über deren Leben und Alltag nicht nur der Colon, sondern auch ihr Mann respektive Vater bestimmte.
Die Töchter der besitzlosen ländlichen Unterschichten hatten im 19. Jahrhundert kaum eine andere Möglichkeit als irgendwo „in Dienst“ zu gehen. Ein Großteil der kaum vierzehn- oder fünfzehnjährigen schulentlassenen Mädchen wurde von ihren Vätern als so genannte kleine Magd in der Landwirtschaft in Stellung gegeben. Die kleine Magd war auf den Höfen der Großmagd unterstellt – sofern eine solche beschäftigt wurde. Die Mägde waren für die Versorgung des Milchviehs, der Schweine und des Kleinviehs zuständig, besorgten den Gemüsegarten und halfen im Haushalt, in der Küche und bei der Feld-arbeit (Garben binden, Kartoffeln aufsuchen, Rüben ziehen), wann immer dies notwendig war. Die Mägde lebten mit der Bauernfamilie unter einem Dach, aßen mit ihr an einem Tisch. Was sie zu tun hatten, bestimmte zunächst einmal die Bäuerin und in letzter Konsequenz natürlich der Bauer.
Der soziale Aufstieg einer aus einer besitzlosen ländlichen Unterschicht stammenden Magd war so gut wie ausgeschlossen, dafür sorgten schon die strengen sozialen Ausschlusskriterien der Bauernfamilien. In den Anerbengebieten galt der Erhalt des Hofes als oberstes Kriterium, durch eine Heirat sollte Land zu Land kommen. Wichtig war es deshalb, dass die Heiratskandidatin des Hoferben „etwas an den Füßen“ hatte, also über eine erkleckliche Mitgift (möglichst an Landflächen) verfügte, so dass der Besitz vermehrt wurde.
Ein Mädchen aus einer landlosen Heuerlingsfamilie wurde als Schwiegertochter gar nicht erst in Betracht gezogen, da konnte sie noch so flink spinnen, backen oder melken und den Garten noch so gut bestellt haben.
In der Regel blieb den Mädchen aus den besitzlosen Schichten nur eine Verehelichung mit ihresgleichen, also einem jungen Mann aus einer Heuerlingsfamilie oder einem verwitweten Heuermann.
Viele dieser Beziehungen bahnten sich auf den dörflichen Spinnstuben, bei den Märkten, Kirchweihfeiern oder Schützenfesten an. Auch die verschiedenen Brauchveranstaltungen wurden nicht zuletzt zum Anbandeln genutzt.
Da es zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht sonderlich schwer war, eine entsprechende Heuerstelle bei einem Bauern zu finden, war das Heiratsalter der Landlosen weitaus niedriger als dasjenige der Bauern, die vor der Hochzeit die Hofübergabe regeln mussten.
Gegen Mitte des Jahrhunderts änderte sich die Lage der Heuerleute jedoch drastisch: Infolge der Krise des Haustextilgewerbes – ein wichtiger Nebenverdienst der Heuerleute – fehlten den jungvermählten Landlosen meist jegliche Mittel, um sich auf einer Heuerstelle eine von ihren Eltern unabhängige Existenz aufzubauen. Meist blieb ihnen keine andere Möglichkeit, als in die Nachfolge ihrer Eltern oder Schwiegereltern zu treten und mit diesen in den ohnehin schon engen Heuerhäusern einen gemeinsamen Haushalt zu bilden. Für die Frauen konnte dies Unterstützung bei der Hausarbeit und Kinderbetreuung bedeuten. Auf der anderen Seite kamen unter Umständen aber noch die Pflege von (Schwieger)Mutter und/oder (Schwieger)Vater zu ihrem ohnehin hohen Arbeitspensum hinzu.
Die beengten und ungesunden Wohnverhältnisse in den nicht selten baufälligen Heuerhäusern machten den Frauen den Alltag nicht eben leicht: Kochen, waschen und Kinder zu gebären und aufzuziehen waren auch unter weit weniger schwierigen Verhältnissen im 19. Jahrhundert kein Zuckerschlecken. Viele Neugeborene bezahlten die unhygienischen Lebensumstände, die oft nicht ausreichende Nahrung und die durch die Arbeitsbelastung und die Geburten teils rasant fortschreitende Entkräftung ihrer Mütter mit dem Leben. Für die Frauen selbst konnte jede Geburt unter solchen Bedingungen den Tod bedeuten.
Auch unter den noch eher positiven Voraussetzungen um die Wende zum 19. Jahrhundert, d.h. mit einem guten Zuverdienst durch Spinnen und Weben bei auskömmlichen Preisen für die Erzeugnisse, waren die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Heuer-lingsfrauen nicht leicht. Ihr Alltag war geprägt von einem enormen Arbeitspensum bei teils nur geringer Zeitsouveränität und dem steten Kampf gegen Ungeziefer und Krankheiten bei Mensch und Tier.
Änderten sich die äußeren Bedingungen aber nur geringfügig zum Schlechteren, so war das Maß des Erträglichen schnell überschritten. Schlechte Erntejahre (erinnert sei hier z.B. an 1816, das so genannte Jahr ohne Sommer), die extreme Teuerungen nach sich zogen, und die sich in den 1830er Jahren allmählich verschärfende Krise der Haustextilherstellung, verschlechterten die Situation der Heuerlings-familien derart, dass ihnen manchmal keine andere Möglichkeit blieb, als sich auf den weiten Weg nach Amerika zu machen, um dem Elend und der Not in der Heimat zu entgehen.
Bei der Beschreibung des Lebens und Alltags von Heuerlingsfrauen im 19. Jahrhundert sei jedoch vor Verallgemeinerungen gewarnt:
Ein Blick in die Kirchenbücher und die amtlichen Unterlagen zeigt, dass sich bei einer mikrohistorischen Perspektive auch viele Unterschiede aufweisen lassen. Die Anzahl der Geburten, die Zahl der überlebenden Kinder, die Möglichkeiten des Zuverdienstes für sie und/oder ihren Ehemann, die Höhe der Pacht und sonstiger zu leistender Zahlungen, die persönliche Beziehung zum Colon, zu den übrigen Landbesitzern und Landlosen des Dorfes beziehungsweise der Bauerschaft oder die Möglichkeit oder Unmöglichkeit auf familiäre Unterstützung zurückzugreifen, konnte das Leben einer Heuerlingsfrau spürbar zum Besseren oder zum Schlechteren verändern.
Die mehrfache Abhängigkeit (von ihrem Vater/Ehe-mann und dem Bauer/der Bäuerin), die freilich individuell als mehr oder weniger drückend empfunden wurde, und die geringe soziale Durchlässigkeit der ländlichen Gesellschaft, die kaum Chancen zum sozialen Aufstieg eröffneten, lassen sich indes nicht wegdiskutieren.
Inwieweit Frauen unter diesen zu jener Zeit herrschenden Konstellationen überhaupt eine Möglichkeit hatten, ihre individuelle Lebenslage aktiv zum Besseren zu verändern, bleibt fraglich.
Erschienen in:
Video: Martin Skibicki Foto: Archiv Robben