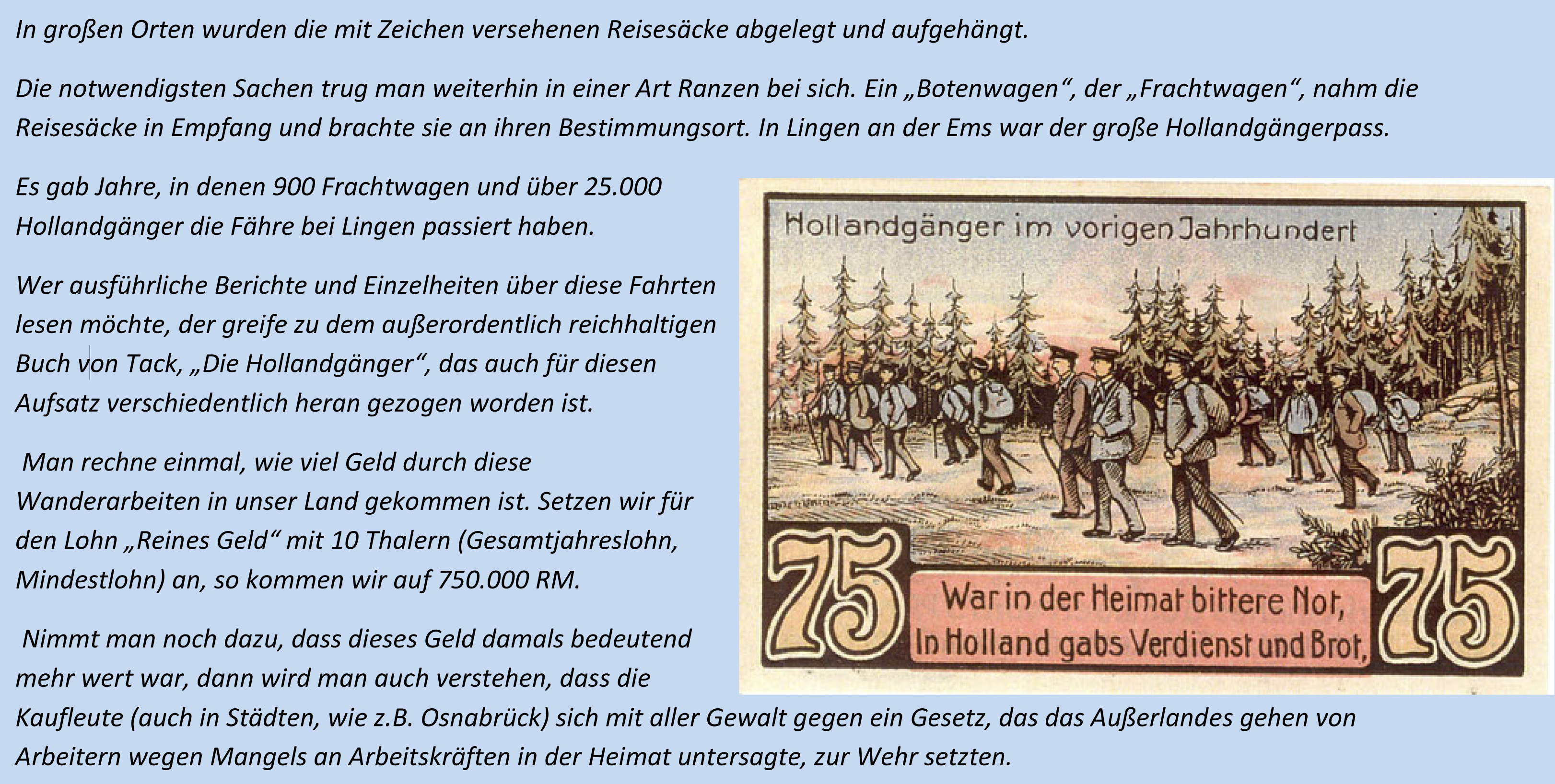Von Bernhard Ottens (1963) –
in:
zur Verfügung gestellt durch Alfons Krüssel vom Heimatverein Hebelermeer

Im Jahr 1866 besiegte Preußen bei Langensalza das Königreich Hannover. Von nun an war Hannover eine Provinz Preußens. Jetzt mußten alle jungen Männer eine dreijährige Dienstzeit in der Preußenarmee Bismarcks ableisten. So etwas war den Hannoveranern fremd und gefiel ihnen gar nicht. Junge Rekruten, insbesondere aus den Emsdörfern, nahmen ihr Erbteil in Bargeld mit und flohen nach Holland. Viele junge Männer aus dem Emsland hatten bis dahin schon in Holland als Hollandgänger gearbeitet und kannten sich somit dort gut aus. Eine geeignete erste Bleibe fanden etliche dieser Flüchtlinge auf dem Traktatland der Hebelermeerer. Auf holländischem Boden direkt jenseits der Grenze hatten die Hebelermeerer Bauern aus der “sogenannten Hannoverschen Abfindung” einen etwa 700 m breiten, etwa 3 km langen Streifen Boden zugeteilt bekommen. Jeder unserer Bauern besaß dort eine oft mehrere Hektar große Fläche. Als Zu-wegung benutzte man je nach “Lage der Dinge” den 12 – 15 m breiten holländischen oder deutschen Grenzstreifen. Beide waren gleichzeitig öffentliche Verkehrswege und dienten auch als Zuwegung für das Traktatland. Hier im Ort nannte man diesen Wegestreifen “Limite”.
Die Flüchtlinge bauten mit Einverständnis und unter Mithilfe des Hebelermeerer Grundbesitzers in wenigen Tagen – nur 20 bis 30 m von der Grenze entfernt – eine richtige Moorkate. Hierbei halfen die künftigen holländischen Nachbarn mit. Nachdem nun einige Möbelstücke und etwas Hausrat beschafft worden war, wurde schnell noch in einer hiesigen Dorfkirche an der Grenze heimlich geheiratet. Und nun ging es bei Nacht und Nebel über die “Grüne Grenze”. Das junge Paar stellte bald den Antrag, holl. Bürger zu werden. Noch bis 1933 gingen viele frühere Flüchtlinge aus Compascuum in Hebelermeer zur Kirche, weil ältere Leute hier einen Gottesdienst in ihrer Muttersprache mitfeiern konnten. Die Entfernung von der Katensiedlung der Flüchtlinge von Compascuum bis zu unserer Kirche betrug nur gut 1 km.
Herr Schulleiter Kuis aus Barger-Compascuum schreibt in den ersten Zeilen seines Dorfbuches, daß bis 80 % der Einwohner “Hannoversche Flüchtlinge” aus dieser Zeit sind. Auf dem Friedhof dort findet man fast nur emsländische Familiennamen. Im Museumsdorf von Barger-Compascuum kann man sich überzeugen, wie bescheiden die ersten Einwohner – unsere “Hannoverschen Flüchtlinge” – dort gelebt haben.
Den Abschluß der Wehrdienstverweigerung macht KI. Herm von hier. Sein Elternhaus stand nur einige 100 m von der holl. Grenze. Sein Vater kaufte zu dem Traktatland in Holland soviel Boden hinzu, daß es ein voller Hof war. Herm baute mit Hilfe seines Vaters ein Haus auf dem abgetorften Boden an dem 1. Kanal. Dann heiratete er sein deutsches Mädchen, die er wegen der rotblonden Haare “Fößken” nannte. Nun hatte Herm einige Jahre vor Beginn des ersten Weltkrieges seine mehrjährige Wehrdienstpflicht in der deutschen Armee abgeleistet. Am ersten Mobilmachungstag, Ende Juli 1914, bekam Herm nach Holland den Einberufungsbefehl, sich sofort in Lingen zu stellen. Herm tat das auch. Er machte als Infanterist die furchtbaren Schlachten bei Ypern und Langemarck mit und bekam zu Weihnachten 1914 Heimaturlaub. Zunächst kehrte er bei seinen Eltern in Hebelermeer ein. Zu seiner jungen Familie nach Holland, die auf Sichtweite wohnte, konnte er nicht, weil die Grenze jetzt im Kriege militärisch von Landsturmleuten besetzt war. Nun war guter Rat teuer. Aber Herm wußte Rat: Um Mitternacht legte er seine Uniform sowie Stiefel und Kopfbedeckung ab, zog den Anzug seines Bruders an, steckte die Uniformsachen nebst Stiefel, Mütze, Koppel und Seitengewehr in einen Sack, verabschiedete sich, schlug den Sack auf die Schulter und sagte: “Mien Fößken ist mi mehr wert as ganz Duitsland.” Nun ging er bei stockdunkler, stürmischer Winternacht im wilden aber ihm bekannten Moor auf Schleichwegen über die “grüne Grenze”. Den Sack stellte er im Grenzgraben ab. Es soll sich darin neben seinen Militärpapieren noch ein Zettel befunden haben mit dem oben bez. Ausspruch. Herm kehrte nach Weihnachten natürlich nicht zur Fronttruppe zurück. Fast nach genau vier Jahren, als auch Herms früherer oberster “Befehlshaber” türmte und sich in Holland als einfacher Bürger niederließ, kam er als holt. Bürger wieder zu Besuch nach Hebelermeer.