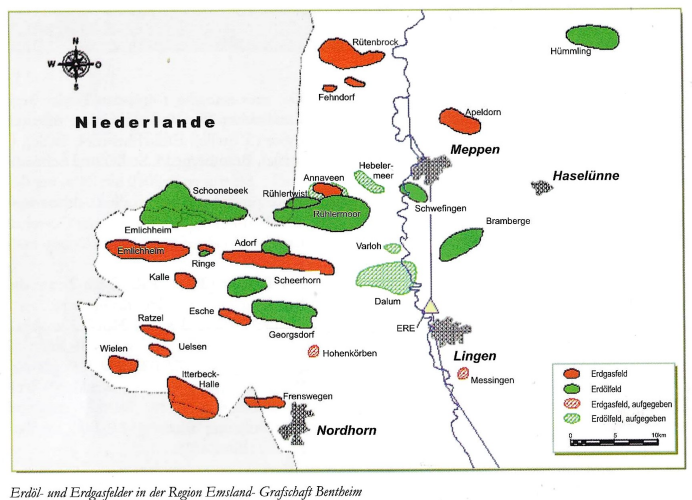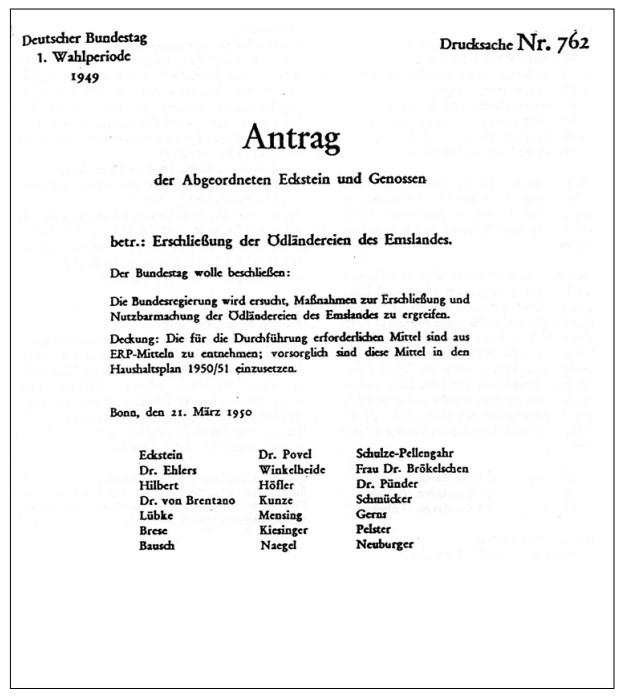Christiane Cantauw ist seit 2005 Geschäftsführerin und wissenschaftliche Referentin der Volkskundlichen Kommission für Westfalen/Kommission Alltagskulturforschung für Westfalen.
Leben und Alltag von Heuerlingsfrauen im 19. Jahrhundert darzustellen, erweist sich als einigermaßen schwierig, standen Frauen doch selten einmal im Fokus sozial- oder wirtschaftshistorischer Beschreibungen.
Entsprechend wenige Quellen liegen über ihr Leben und ihren Alltag vor. In der Regel waren es die Männer, allenfalls die Familien als Ganzes, über deren soziale oder wirtschaftliche Lage in den aufklärerischen oder sozialreformerischen Schriften raisonniert wurde.
Frauen, das betraf nicht nur diejenigen aus den unteren sozialen Schichten, waren in der patriarchalisch geprägten Gesellschaft des 19. Jahrhunderts in allen Belangen dem Mann nachgeordnet. Diese Stellung war nicht zuletzt rechtlich fixiert, so dass Frauen – unabhängig davon, ob sie nun verheiratet waren oder nicht — der ihnen seitens der Gesellschaft zugewiesenen passiven Rolle nur schwerlich entkommen konnten.
Waren die Heuerlinge — je nach dem (meist mündlich verabredeten) Pachtvertrag, den sie mit dem Colon abgeschlossen hatten, und je nach den zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten durch Spinnen, Weben, Zigarrenmachen, Hollandgängerei etc. — in mehr oder weniger hohem Maße abhängig von den Besitzenden, so galt diese Abhängigkeit umso mehr für ihre Frauen und Töchter, über deren Leben und Alltag nicht nur der Colon, sondern auch ihr Mann respektive Vater bestimmte.
Die Töchter der besitzlosen ländlichen Unterschichten hatten im 19. Jahrhundert kaum eine andere Möglichkeit als irgendwo „in Dienst“ zu gehen. Ein Großteil der kaum vierzehn- oder fünfzehnjährigen schulentlassenen Mädchen wurde von ihren Vätern als so genannte kleine Magd in der Landwirtschaft in Stellung gegeben. Die kleine Magd war auf den Höfen der Großmagd unterstellt — sofern eine solche Arbeit (Garben binden, Kartoffeln aufsuchen, Rüben ziehen), wann immer dies notwendig war. Die Mägde lebten mit der Bauernfamilie unter einem Dach, aßen mit ihr an einem Tisch. Was sie zu tun hatten, bestimmte zunächst einmal die Bäuerin und in letzter Konsequenz natürlich der Bauer.
Der soziale Aufstieg einer aus einer besitzlosen ländlichen Unterschicht stammenden Magd war so gut wie ausgeschlossen, dafür sorgten schon die strengen sozialen Ausschlusskriterien der Bauernfamilien. In den Anerbengebieten galt der Erhalt des Hofes als oberstes Kriterium, durch eine Heirat sollte Land zu Land kommen. Wichtig war es deshalb, dass die Heiratskandidatin des Hoferben „etwas an den Füßen“ hatte, also über eine erkleckliche Mitgift (möglichst an Landflächen) verfügte, so dass der Besitz vermehrt wurde.
Ein Mädchen aus einer landlosen Heuerlingsfamilie wurde als Schwiegertochter gar nicht erst in Betracht gezogen, da konnte sie noch so flink spinnen, backen oder melken und den Garten noch so gut bestellt haben.
In der Regel blieb den Mädchen aus den besitzlosen Schichten nur eine Verehelichung mit ihresgleichen, also einem jungen Mann aus einer Heuerlingsfamilie oder einem verwitweten Heuermann. (…)
Fortsetzung folgt…
aus:

Bernd Robben/Martin Skibicki/Helmut Lensing/Georg Strodt
Heuerhäuser im Wandel – Vom ärmlichen Kotten zum individuellen Traumhaus
Haselünne 2017 Seite 227/228