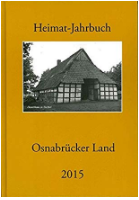Lübbert zur Borg, Borg veröffentlichte in den Menslager Heften Auszüge aus:
1847 – Pastor Funkes
Buch über Probleme des Heuerleutesystems
(Auf dieser Seite ist im Aufsatz die Titelseite des Buches abgebildet. Dafür hier der Text des Titels)
Ueber diegegenwärtige Lage der Heuerleute im Fürstenthume Osnabrück,
mit besonderer Beziehung auf die Ursachen ihres Verfalls und mit Hinblick auf die Mittel zu ihrer Erhebung.
So ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit.
- Kor. 12, 26
Von Georg Ludwig Wilhelm Funke. Pastor zu Menslage
Bielefeld,Verlag von Velhagen & Klasing 1847
Lübbert zur Borg schreibt:
Aus Platzgründen kann leider nur sehr gekürzt und zusammengefaßt auf den Inhalt des Buches eingegangen werden.
Grundsätzlich ist es wünschenswert, wenn dieses Buch in vollständiger Fassung – evtl. als Faksimile-Nachdruck zur Verfügung gestellt werden könnte, da es eine Fülle von Informationen für den an der Heimatgeschichte Interessierten enthält.
| Nach dem Tode von Pastor Möllmann im Jahre 1839 gab es bekanntlich mehrjährige Auseinandersetzungen um die Neubesetzung der Menslager Pfarrstelle. Die Einsetzung des unerwünschten Kandidaten Fachtmann konnte zwar verhindert werden, gegen den vom Konsistorium vorgeschlagenen Pastor Georg Ludwig Wilhelm Funke, der ebenfalls nicht erwünscht war, konnte die Kirchengemeinde sich dann nicht mehr wehren[1]. Er wurde 1842 eingesetzt und blieb bis zu seiner Versetzung im Jahre 1858 in Menslage. |
Nach uns vorliegenden Unterlagen war Pastor Funke nicht sehr beliebt und erfuhr nur wenig Anerkennung im Kirchspiel. Unabhängig davon entwickelte er sich aber zu einem guten Kenner der hiesigen Verhältnisse. Sein besonderes Interesse fand die zu der damaligen Zeit prekäre Lage der Heuerleute[2]. Schon 1846 veröffentlichte er einen Artikel im Hannoverschen Magazin, Nr. 13 – 17 mit dem Titel: „Über die gegenwärtige Lage der Heuerleute im Fürstenthume Osnabrück“. Angeregt durch ein allgemeines Interesse und nach mehreren privaten als auch öffentlichen Aufforderungen, überarbeitete und erweiterte Funke seinen Aufsatz zu einem 84seitigen Buch, das er 1847 beim Verlag Velhagen und Klasing in Bielefeld herausgab.
Der vollständige Titel lautet:
Ueber die gegenwärtige Lage der Heuerleute im Fürstenthume Osnabrück, mit besonderer Beziehung auf die Ursachen ihres Verfalls und mit Hinblick auf die Mittel zu ihrer Erhebung
Ein nachgestellter Bibelvers im Titel
„So ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit.
- Kor. 12, 26“
deutet auf Funkes seelsorgerisches Verantwortungs- und Mitgefühl. Seine Bemühungen gingen in die Richtung, daß dem Heuerleutestand sofort und nachhaltig geholfen werden müsse, um noch größeren Schaden vom gesamten Gemeinwesen fernzuhalten. Bestand die Bevölkerung doch zu etwa zwei Dritteln aus den Heuerleuten.
Der Text des Buches ist folgendermaßen gegliedert:
Einleitung
- Die Entstehung der Heuerleute
- Verhältnis derselben zum Colonen[3]
- Ihre Verarmung
Erster Abschnitt
Ursachen der Noth der Heuerleute
- Der Einfluß der Bodencultur auf die Lage der Heuerleute
- Der Verfall der häuslichen Industrie in Flachs, Hanf und Wolle
- Die Verringerung des Verdienstes in Holland
- Die Nachtheile der Markentheilung für die Heuerleute
- Die unbestimmten Dienste oder die Haushülfe
- Die Schul-, Kirchen-, Communal- und Staatslasten der Heuerleute
- Der Luxus und die Vergnügungssucht besonders bei den Dienstboten
- Die Stimmung der Heuerleute
Zweiter Abschnitt
Mittel zur Verbesserung der Lage der Heuerleute
- Die Einwirkung der Auswanderung nach Amerika auf den Zustand der Heuerleute
- Die Vergrößerung der Heuern und die Verbesserung der Landwirthschaft durch Wiesencultur, vermehrte und sorgfältigere Düngung und durch besseren Fruchtwechsel
- Die Hebung der Industrie
- Schluß
Schon die systematische Ordnung des Inhaltes deutet auf umfassende Sachkenntnis und analytische Fähigkeiten des Verfassers. Die Lektüre des Buches bestätigt diesen ersten Eindruck und zeigt, daß Pastor Funke neben seiner theologischen Bildung großes Wissen über die damaligen politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge besaß. Auch scheute er sich nicht, eventuell unbequeme Wahrheiten deutlich auszusprechen.
Im folgenden sollen nun seine wichtigsten Erkenntnisse zur Lage der Heuerleute, einige allgemeine Angaben zur damaligen Situation[4] und seine wesentlichen Schlußfolgerungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Heuerleute kurzgefaßt dargestellt werden.
Im Vorwort geht Funke auf die Gründe seiner Veröffentlichungen ein und schreibt unter anderem:
… Hier muß ich noch hinzufügen, daß, wenn meine Beobachtungen über die Lage der Heuerleute bei der gegenwärtigen in Folge der vorjährigen Mißernte sich immer weiter verbreitenden großen Noth geschrieben wären, ihre Lebensverhältnisse in einem noch viel ungünstigeren Lichte, als sie von mir dargestellt sind, erscheinen würden. Freilich haben sich in diesem Augenblick die Garn- und Leinenpreise wieder etwas gehoben; alleine was hilft dies bei der jetzigen Theuerung, wenn bei den Heuerlingsfamilien zum großen Theil gar keine Vorlagen[5] da sind, und durch die Verwerthung der Arbeitskräfte nicht mehr des Lebens Nothdurft herbeigeschafft werden kann! Wahrlich, wenn irgend je, so werden wir in gegenwärtiger Zeit auf das ernstlichste gemahnt, die noch vorhandenen Heilkräfte zum Kampfe gegen das immer weiter um sich greifende Übel der Verarmung der unteren Volksklassen anzuregen und zu vereinen! Geschieht dieß nicht, so wird diese Verarmung massenhaft in solcher Weise zunehmen, daß eine Heilung der Krankheit kaum noch möglich ist, wie solches auf das schreckerregendste gerade jetzt Beispiele in anderen Ländern zeigen. Wenn wir nun die Klasse der Heuerleute unzweifelhaft als ein krankes Glied im Organismus des Staates anzusehen haben, und ebendarum eine Heilung durchaus nothwendig ist, so liegt es jedoch gerade im Wesen der Heilung, daß diese nicht etwa von den kranken, sondern von den noch gesunden Theilen ausgeht, durch deren Lebenskräfte die Krankheit immer mehr zurückgedrängt werden muß, damit die leidenden Glieder zur Gesundheit gelangen und sodann als wahrhaft lebendig dem Organismus wieder einverleibt werden können.
Wir dürfen darum bei der überhand nehmenden Verarmung der Heuerleute, solange wir noch Lebenskräfte in uns verspüren, nicht ruhig bleiben; sondern wir müssen das Übel in allen seinen Ursachen angreifen und zu überwältigen suchen. Eine bloße Unterstützung der Heuerleute, ohne daß die Ursachen ihrer Noth beseitigt wären, wird nur augenblicklich das Übel lindern, auf die Dauer aber nichts fruchten, indem die Noth stets wiederkehrt, die Mittel zur Unterstützung aber endlich erschöpft werden. …
Zur Einleitung (Kapitel 1-3)
Nach der letzten Volkszählung von 1845 lebten im Fürstentum Osnabrück 153.412 Menschen. Davon entfielen ca. 25.000 auf die Städte Osnabrück, Quakenbrück, Fürstenau und die übrigen Kirchdörfer. Auf das sog. platte Land entfielen somit ca. 5/6 der Bevölkerung. Hiervon waren wiederum zu der Zeit etwa 2/3 Heuerleute. Es bestand demnach allgemein ein Verhältnis von 1 : 2 zwischen der landbesitzenden und der landlosen Bevölkerung.
Funke schreibt, daß dieses Zahlenverhältnis nicht überall gleich ist und gibt im Kapitel 4 nähere Einzelheiten. Für das Kirchspiel Menslage war nach einem Bericht[6] der Vogtei Menslage an die Regierung in Osnabrück das Verhältnis noch größer. Hier kamen auf 159 Grundbesitzerfamilien 372 Heuerleutefamilien. Das ist ein Verhältnis von 1 : 2,33.
Im übrigen brauchen die weiteren Erklärungen von Funke zur Entstehung der Heuerleute hier nicht weiter erläutert zu werden, da diese hinlänglich oft beschrieben wurden und allgemein bekannt sind. Er schreibt jedoch unmißverständlich: … Wie der Stand der Heuerleute sich gebildet hat, darüber kann man nicht lange zweifelhaft sein, wenn man ihre Namen mit denen der Höfe, aus welchen eine Gemeinde besteht, vergleicht. Es sind mit geringen Ausnahmen immer dieselben. …
Der Beschreibung der oft unzulänglichen Wohnverhältnisse widmete er ausreichend Raum, da ihm diese doch sehr verbesserungswürdig erschienen. Um auch den Lesern, die nicht mit den hiesigen Verhältnissen vertraut waren, einen Einblick in die Wohnverhältnisse zu geben, ist im Text folgende Skizze eingefügt.
(Skizze fehlt hier)
Als Erklärung von ihm dazu:
Nehmen wir an, daß ein nach vorstehendem Grundrisse erbautes Haus von zwei (!) Familien bewohnt würde, so wäre a der Doppelheerd, b die gemeine Dreschdiele, c der Wasch- und Standort der Küchengeräthe, d Wohnstube, e Durtige zum Schlafen, f Kammer für Aufbewahrung der Lebensmittel, g Stallung für das Vieh.
Bemerken müssen wir jedoch, daß f nicht selten fehlt und dann ein Heuerhaus verhältnismäßig um soviel kürzer zu sein pflegt.
Weiterhin schrieb Funke u.a.:
… Weil Keller in den Heuerhäusern fehlen, so müssen viele Lebensmittel, welche leicht verfrieren, im Durtig unterhalb des Bettes oder unter den Kisten, Koffern, Schränken und in Tonnen, welche die Ecken füllen, aufbewahrt werden. Alles, was die Familie während des Winters bedarf, ist also auf einem kleinen Raum zusammengedrängt, und ist der Dunst davon oft Monate lang zu ertragen. Dazu kömmt noch der Staub der Spinnräder, die Ausdünstung der Menschen bei Tage und bei Nacht usw., so daß man sich in der That oft wundern muß, wenn diese in einem solchen Raum noch gesund bleiben. …
Das Verhältnis der Heuerleute zu ihren Colonen beschreibt Funke als im allgemeinen recht gut und patriachalisch und durch gegenseitige Rücksichtnahme gekennzeichnet. Er beklagt jedoch, daß der „moderne Zeitgeist die vorhandenen sittlichen Bande zerreißt“ und sich verderblich auswirkt. Er dachte dabei an die wachsende Entfremdung zwischen Colonen und Heuerleuten, auf die er zum Schluß des 8. Kapitels nochmal eindeutig hinweist (siehe dort in den betr. Erläuterungen).
Zum Schluß der Einleitung stellt Funke dann fest, daß in den vergangenen Jahrzehnten die Heuerleute zunehmend verarmt sind, da ihnen die notwendigen Erwerbsquellen fehlen. Die einzelnen Gründe sind in den folgenden Kapiteln 4 – 8 genauestens beschrieben. Als Beweis der großen Not schreibt er:
… Es muß in der That schlimmer stehen, als man meist zu glauben geneigt ist, wenn Schulen da sind, in welchen 1/4, ja sogar 1/3 der zu unterrichtenden Kinder arm sind, so daß für sie das Schulgeld aus Armen- oder Communalmitteln bezahlt werden muß; und dies ist in Ortschaften der Fall, wo vielleicht noch vor wenigen Jahren das fünfzehnte oder höchstens das zwölfte Kind ein armes war. Alle diese armen Kinder sind aus dem Stand der Heuerleute.
Zu Kapitel 4
Da in diesem Kapitel interessante Angaben zur Landeskultur des ganzen Fürstentums Osnabrück gemacht werden, folgt hier der Text in ungekürzter Originalfassung.
Einfluß der Bodencultur auf die Lage der Heuerleute
In den verschiedenen Theilen des Fürstenthums Osnabrück sind die Verhältnisse der Heuerleute keineswegs sich durchweg gleich, wenn sie auch überall drückend sein mögen. Freilich ruhen sie überall auf der gleichen Grundlage; allein hierbei treten so viele Modificationen ein, daß nicht blos die Lebensweise in dem nördlichen Theile (den Aemtern Fürstenau, Bersenbrück, Vörden und dem gegenwärtig mit Wittlage combinirten Hunteburg) und in den südlichen (den Aemtern Osnabrück, Iburg, Grönenberg und Wittlage) vielfach verschieden ist, sondern häufig auch in ganz nahe bei einander liegenden Kirchspielen. Der fruchtbarere Theil des Fürstenthums ist im ganzen der südlichere. Im Amte Grönenberg kommen (vergl. Osnabr. Hausfreund, 1845, Nr. 11) auf die Quadratmeile 6100 Einwohner[7]; dieses Amt ist fast überall gleichmäßig bebauet[8], eignet sich ganz vorzüglich zum Flachsbau und hat nur geringe Gebirgsstrecken und so gut als gar keine Heidestriche. Die Lage der Heuerleute ist hier indeß vorzugsweise ungünstig, weil die Gemeinheiten[9] so gut als ganz fehlen und ihr Haupterwerb hier von je her Spinnen und Weben gewesen ist. Ueberall zeigt sich, daß gerade die fruchtbareren Gegenden es sind, in welchen die Heuerleute am wenigsten gut fortkommen, obwohl es ihnen keineswegs an Betriebsamkeit fehlt.
Nach Grönenberg kömmt das Amt Wittlage im engeren Sinne, welches ebenfalls durchweg fruchtbar ist, wenn auch schon auf die Gebirge eine größere Fläche fallen mag, und mehrere Bruchstriche vorhanden sind; indeß sind die Bruchstriche zum großen Theil in Wiesen umgewandelt. Jedenfalls gehört das eigentliche Wittlage zu den freundlichsten und angebautesten Gegenden des Fürstenthums. Im hinzugekommenen Amte Hunteburg ist das Verhältniß ein anderes. Die Höhen, von welchen Wittlage durchzogen wird, setzen sich zwar in den Kirchspielen Osterkappeln und Venne fort; allein das Laubholz schwindet allmälig, namentlich hat Osterkappeln mehrere unfruchtbare Gebirgsstrecken; wohl angebaut dagegen ist die nordöstliche Abdachung nach der Hunte und zum Theil deren Niederung um Bohmte, obwohl es auch hier in nördlicher Richtung an Heide nicht fehlt. Der ganze nördliche Theil des Amtes besteht aus großen Mooren und Brüchen, von welchen Hunteburg halbinselartig von drei Seiten umgeben wird. Für die Cultivirung dieser Moor- und Bruchstriche, des Venner, Schweger, Cappeler und Welplager Moores und der eben benannten Brüche, kann jedenfalls noch viel geschehen und zwar sowohl durch Trockenlegung des Moores als Bewässerung der Bruchstriche, welches beides, mag auch der Fall des Gewässers nur gering sein, doch gewiß sehr wohl auszuführen wäre, zumal wenn hier eine Verbindung der Hase und Hunte bewirkt würde.
Wenn in Wittlage die Verhältnisse der Heuerleute sehr ungünstig erscheinen, weil Spinnen und Weben vorzugsweise als Erwerbsquellen zu betrachten sind, so stellen sich ihre Umstände in Hunteburg, wo es noch viele unbebaute Heide-, Bruch- und Moorflächen gibt, schon besser heraus, zumal da im ganzen in dieser Gegend die Wiesen gut sind, so daß verhältnißmäßig viel Rindvieh und in den Bruchgegenden auch Gänse gehalten werden können. Im combinirten Amte Wittlage-Hunteburg kommen 4007 Einwohner auf die Quadratmeile, obwohl Wittlage nicht geringer bevölkert ist, als Grönenberg.
Der gebirgigste Theil des ganzen Fürstenthums ist das Amt Iburg, und wenn auch die nähere Gebirgsumgebung des reizenden Iburg schön und lieblich sein mag, so können wir doch nicht alle Berge so nennen, indem die höheren derselben meistens kahl und öde sind; doch findet man an deren Fuße oft schöne Thäler, meistens von einem Bache bewässert, in welchen für die Wiesencultur gewiß noch Vieles geschehen könnte. Fruchtbar ist besonders der östliche Theil des Amtes, wogegen die südwestliche Abdachung des Gebirges nach dem Münsterschen Flachlande große Heiden und kleine Moorstriche hat; doch kommen trotzdem 4237 E. auf die Quadratmeile. Auch hier ist besonders im östlichen Theile des Amtes der Flachs- und zugleich der Hanfanbau bedeutend. Das sog. Schier- und Segeltuch wird hier vorzugsweise verfertigt.
Am wenigsten angebaut und auch bevölkert ist, wenn wir die Stadt Osnabrück nicht mit zählen, unter den südlichen Aemtern das Amt Osnabrück. Fruchtbar ist besonders die nähere Umgebung der Stadt Osnabrück und der oberhalb derselben an der linken Seite der Hase belegene Theil des Amtes; der nördliche und östliche berg- und hügelige, also durchweg sehr unebene Theil mag fast eben so viele Sand-, Heide und Bergstriche haben, als angebautes Land und Wiesen. Mit Einschluß Onabrücks wohnen hier auf der Quadratmeile durchschnittlich 4923 Menschen, ohne dasselbe 3993.
Weniger bevölkert ist der nördliche Theil des Fürstenthums. Der Boden ist hier mit Ausnahme der Hasegegenden wenig zum Flachsbau geeignet; daher waren hier die Heuerleute mehr auf den Ackerbau gewiesen und gingen sodann auch mehr als aus dem südlichen Theile als Handarbeiter nach Holland. In den Heidegegenden, wo Schafe gehalten werden konnten, als die Marken noch nicht geteilt und mit Kiefern besamt waren, und theilweise noch gehalten werden, trat und tritt strichweise noch jetzt die Wollarbeit als Beschäftigung für die Nebenstunden statt der Bearbeitung des Flachses und Hanfes ein; doch findet dabei der bedeutende Unterschied statt, daß die Wollarbeit nie die Hauptbeschäftigung der Heuerleute gewesen ist, wie solches von der Arbeit in Flachs und Hanf zu behaupten steht. An der unteren Hase, wo der Flachsbau wieder bedeutender ist, hat man sich weniger auf Weben als auf Spinnen gelegt; indem nur Garn in bedeutenden Quantitäten von da in den Handel kam, wogegen der Absatz des Leinens immer unbedeutend geblieben ist.
Das Amt Vörden ist zwar an der Hase wohl angebaut, doch gibt es hier weite Heidestriche ( das Wittefeld) und Moore (das große Moor zwischen Vörden und Hunteburg); Am fruchtbarsten ist, wiewohl nicht durchweg, das Kirchspiel Bramsche. Das Amt zählt 2649 Einw. auf die Quadratmeile. Der größte Theil der Population kommt auf die Hasegegend, welche deßhalb sehr bevölkert ist, weil hier gute Wiesen eine erhöhte Agricultur möglich machen. Für die Anlage künstlicher Wiesen ist hier schon Vieles geschehen und wird noch unendlich viel mehr geschehen können. Freilich ist der Boden hier besonders im sog. Wittenfelde sandig, aber doch nicht der Cultur wiederstrebend; bei der niedrigen Lage würde wenigstens für einen Theil desselben wohl eine Bewässerung möglich sein.
Das bevölkertste Amt in diesem nördlichen Theile ist Bersenbrück; in diesem Amte gehört das sog. Artland, die fruchtbare Niederung an der unteren Hase, welche die Kirchspiele Gehrde, Badbergen und Menslage und die Feldmarken der Stadt Quakenbrück umfaßt, zu den bevölkertsten Gegenden des Fürstenthums. Im Amte Bersenbrück kommen 3027 Menschen auf die Quadratmeile. Das Artland mag ungefähr Ein Drittel des Areals einnehmen, welches gegen 22.774 Einwohner zählt. Da von dieser Population 11.780 auf das Artland kommen, so würde dieses ungefähr 4.000 Menschen auf der Quadratmeile ernähren. Es ist dies sehr viel, wenn man bedenkt, daß Badbergen Bruch-, Gehrde Bruch- und auch kleinere Heidstriche hat und das auf Menslage an der Nord- und Westgrenze zudem noch ein bedeutender Theil des sog. Hahnenmoores und Herberger Feldes kömmt.
Das über 7.200 Einwohner zählende große höher liegende Kirchspiel Ankum ist nur in den niederen Bauerschaften an der Grenze von Badbergen und Menslage fruchtbar, in den übrigen Theilen wird es vielfältig von unangebauten Heidhügeln durchzogen, hat aber schöne Bäche, welche mehr, als geschehen ist, zur Wiesencultur benutzt werden könnten.
Fruchtbarer sind im ganzen die kleineren Kirchspiele Alfhausen und Bersenbrück, welche unweit der Hase liegen und daher mehr Wiesen haben. Auch enthält der Boden hier mehr Lehmtheile; doch können Flachs, Waizen, Gerste, Raps hier nur an ganz einzelnen Stellen gebaut werden.
Auch im Amte Bersenbrück haben wir die Erscheinung, daß die Noth der Heuerleute im fruchtbaren Artlande grösser ist als im übrigen Theile und zwar auch wieder aus dem einfachen Grunde, weil sie hier mehr eine gewerbetreibende als ackerbauende war. Würden erst hier solche Culturverbesserungen unternommen, wie es die Natur des Landes verlangt, so könnte es nicht fehlen, daß allen Heuerleuten geholfen werden könnte, und daß auch jetzt nicht über zu große Population zu klagen wäre. In keinem Theile des Fürstenthums wird nämlich wohl so leicht der Boden in der Weise durch eine Benutzung der Wasserkräfte umgestaltet werden können, wie namentlich hier es möglich ist, wenn man nämlich aus der Hase unterhalb Bersenbrück links einen Canal ableitete, durch welchen eine Bewässerung der unteren Bauerschaften des Kirchspiels Ankum und des links der Hase gelegenen Theils der Kirchspiele Badbergen und Menslage möglich gemacht würde, so daß die niedriger fließende sog. kleine Hase wieder zur Abwässerung diente. Die bereits vorhandenen Wiesen und Weiden würden nicht blos auf das außerordentlichste verbessert, sondern zudem noch große Grasflächen hervor gerufen werden, wie sie bis dahin im Fürstenthume nicht zu finden sind.
Der unfruchtbarste Theil des Fürstenthums ist das von Heidestrecken und Mooren durchzogene und dabei überall sandige Amt Fürstenau, wo nur 1.938 Menschen auf die Quadratmeile kommen. Und doch müssen wir behaupten, daß auch hier für die Cultur des Bodens Vieles geschehen könnte, da aus den vielen Höhen überall Bäche hervorquellen, die aber längst nicht genug benutzt werden, so daß in diesem Amt, zumal die Heidschnucken immer mehr verschwinden, viel zu wenig Vieh für die Bedüngung des Ackers gehalten wird. Dazu kommt, daß auf dem mageren Sandboden die Kartoffel, welche dem Boden kein Stroh zurück gibt, unverhältnißmäßig viel gebaut wird, wovon die nothwendige Folge eine stete Verschlechterung des Ackerbodens ist. Die Heuerleute finden hier indeß noch besser ihr Auskommen als in vielen anderen Gegenden; deßhalb ist im Ganzen die Auswanderung, das Kirchspiel Bippen ausgenommen, noch nicht sehr bedeutend geworden.
Es ist einleuchtend, daß die verschiedene Bodencultur des Fürstenthums auch auf die Heuerleute einen nicht zu verkennenden Einfluß übt. In Gegenden, welche wie Grönenberg, das eigentliche Wittlage, das südöstliche Iburg und Osnabrück und das ganze Artland, sehr bevölkert sind, kann der Colon dem einzelnen Heuerlinge weniger Land zur Bebauung geben, als dies in den minder angebauten Landstrichen der Fall ist. Oft sind es nur wenige Scheffel Saat, durchweg aber nicht soviel, daß der Heuerling das nöthige Brotkorn selbst bauen, geschweige etwas zum Verkaufe erübrigen kann. Es ist mithin nothwendig, daß eine Heuerlingsfamilie sich nebenbei etwas erwirbt, und dies geschah besonders in den genannten Theilen des Fürstenthums in dem Maße, daß wir sie in Beziehung auf die Heuerleute gar nicht ackerbauende, sondern nur gewerbetreibende Gegenden nennen können. Da die fruchtbaren Striche im Süden und die ganze Haseniederung im Norden sich sehr wohl zum Flachsbau eignen, so ist Spinnen und Weben von jeher ein Haupterwerbszweig der ländlichen Population, besonders der Heuerleute gewesen, wie denn ja auch ein Spinnrad das alte Osnabrücksche Wappen ist. Auch Hanf gedeiht zum Theil recht gut, z.B. in dem südwestlichen Striche des Amtes Iburg, von wo aus hänfene, sogenannte Löwendleinen und Segeltücher in den Handel kommen.
In den nördlichen Aemtern wurde, die Gegend um Bramsche etwa ausgenommen, wenig Leinen zum auswärtigen Verkaufe gewebt, dagegen ist das Garn früher in großen Quantitäten nach Holland verkauft worden. Aus Menslage z.B. ging es vorzugsweise nach Enschede. In den unfruchtbaren Heidegegenden, wo Flachs nur in geringer Quantität und dabei von schlechterer Qualität gebaut werden konnte, wandte sich die häusliche Industrie der Wolle zu. Die großen Heideflächen gaben Gelegenheit, mit wenigen Kosten Heidschnucken zu halten, aus deren Wolle man entweder Strümpfe strickte oder das sogenannte Wollaken bereitete und nach Holland absetzte.
Zu Kapitel 5
Der Verfall der häuslichen Industrie in Flachs,
Hanf und Wolle.
Zu diesem Thema schrieb Funke mehrere Seiten. Eingehend hat er die verschiedenen Probleme der häuslichen Textilverarbeitung beleuchtet. Es würde hier zu weit führen, wenn die an sich sehr interessanten Aspekte ausführlich beschrieben würden. Es ist allerdings erstaunlich, wie genau Funke auch über die internationalen Bezüge wie Zölle, Schiffsfrachtbedingungen, Einfluß der Baumwolle usw. informiert war. Kurz gefaßt kann man folgende Gründe für den Niedergang der heimischen Textilindustrie angeben:
- Der Verdienst beim Spinnen von Flachs lohnte die Arbeit nicht mehr, so daß zum Teil schon der Flachs unverarbeitet verkauft wurde.
- Das Weben von Leinen und Wollaken, daß anfänglich einen besseren Verdienst versprach, wurde ebenfalls zunehmend unrentabler[10]. Die Gründe dafür sind die Konkurrenz der neuen Webmaschinen, die vermehrte Einführung von Baumwolle und Handelsbehinderungen durch Zölle beim Versand von Leinen in die tropischen Länder.
Funke betont in diesem Kapitel noch besonders, das die Heuerleute z.B. in den Kirchspielen Berge und Bippen nicht ganz so hart betroffen seien, da das dortige Verarbeiten von Wolle immer nur eine Nebenbeschäftigung gewesen sei. In den Gegenden mit Flachsanbau und -verarbeitung sei dies wegen des hohen Arbeitsaufwandes fast die Hauptbeschäftigung der betroffenen Heuerleute gewesen.
Zu Kapitel 6
Die Verringerung des Verdienstes in Holland
Obwohl in der Heimatliteratur über die Hollandgänger viel berichtet worden ist, sollen hier doch einige authentische Aussagen des Zeitzeugen Funke auszugsweise angeführt werden.
… Als Handarbeiter, die nach Holland gehen, sollen jährlich gegen 25.000 die Brücke zu Lingen passiren. … Die Beschäftigung ist eine Verschiedene; doch ziehen die meisten dieser Arbeiter als Grasmäher und Torfbaggerer fort. Andere sind Gärtner, Maurer, Tischler, Zimmerleute, Leimkocher, Matrosen, Musikanten u.s.w. … Die Grasmäher gehen vorzüglich nach Nordholland, die Torfbaggerer mehr nach Groningen und Westfriesland; jene sind in der Regel ungefähr zwei Monate abwesend, ihr Verdienst betrug früher reichlich 30 bis 40 holländische Gulden, welche sie frei zu Haus brachten; gegenwärtig ungefähr 20 holländische Gulden (= 10 Thaler Gold); diese sind gegen drei Monate abwesend und mochten früher wohl 100 holländische Gulden mitbringen, wogegen sie jetzt 30 bis 40 Gulden mitzubringen pflegen. …
Eine große Heuer, bei der viel Land zu bestellen ist. konnte unter solchen Umständen, wo die Frau mit Kindern, die der Pflege vielleicht noch bedurften, allein zurückbleiben mußte, früher den Hollandgängern nur eine Last sein; sie wünschten sie daher auch gar nicht zu erlangen. Als noch 30 – 40 Gulden freies Geld in 6 Wochen und 80 – 100 Gulden in einem Vierteljahr verdient wurden, konnten die Pachtgelder beinahe aus Holland geholt werden, wenn die Heuer nicht zu groß war. Der Verdienst mit Spinnen, Weben und sonstiger Handarbeit reichte dann für die weitere Unterhaltung einer Familie beinahe aus, zumal wenn aus der Viehzucht auch noch Geld gemacht werden konnte. Es ist dieses alles jetzt wesentlich anders geworden. …
… Ganz versiegen wird diese Erwerbsquelle zwar nicht, indem die Holländer beim Torfbaggern und Grasmähen für den Augenblick mehr Leute nöthig haben, als das Land giebt; allein bei der Abnahme des Reichthums in Holland ist nicht daran zu denken, daß sie je wieder reichlicher fließen wird, zumal da die Holländer anfangen, solche Arbeiten, wie Heuen und Grasmähen, sogar das Torfbaggern selbst zu übernehmen. …
… Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß die Hollandgänger nicht sehr alt werden – und wie könnte dieses auch wohl anders sein! Bei Tage Erhitzung und bei Nacht Erkältung, da sie kein Bett zu sehen bekommen; dabei schwere Arbeiten mitunter halb im Wasser, und sogar noch schlechte Kost, indem sie sich alles, was nur möglich ist, abdarben; – welche Gesundheit könnte da für die Dauer bestehen! Als Hungerleider kehren sie zu ihren Familien zurück, nicht selten schon den Todeskeim in sich tragend. Welken sie dann frühzeitig dahin, so fällt meist die Familie der Gemeinde zur Last …
… Gutes Geld wurde früher auf holländischen Schiffen verdient. Zwar hat dieser Erwerb noch nicht völlig aufgehört, ist aber für das Ganze von keinem Belang mehr. Da der holländische Seeverkehr nie wieder das werden kann, was er früher war, vielmehr fortwährend abnehmen wird, so ist nicht daran zu denken, daß je wieder das Verhältniß einer früheren Zeit eintreten wird, in welcher Viele aus unserem Fürstenthume (besonders aus dem Kirchspiele Gehrde, auch aus Menslage) in ihren kräftigen, jüngeren Jahren auf Fahrten nach Ost- und Westindien und durch Theilnahme am Herings- und Wallfischfange in kurzer Zeit ein kleines Vermögen erworben haben, ja mitunter zu einigem Reichthume gelangt sind.
Fassen wir zusammen, was wir über den Handel und Verkehr mit Holland und über die Handarbeiten daselbst andeuteten, so dürfte die einfache Schlußfolge sein, daß die materiellen Vortheile, welche die hiesige Gegend von dort her hatte, sich fortwährend vermindern und daß keine Aussicht da ist, wie es in dieser Hinsicht besser werden kann; Daß es aber gegenwärtig bei dem geringen Verdienste für Familienväter vortheilhafter ist, hier zu bleiben, als ihre Kräfte dem Auslande zuzuwenden, mögen auch noch immer unverheirathete junge Arbeiter, die hier nichts versäumen, dort leichter sich ein kleines Capital, womit sie ein eigenes Hauswesen anfangen, erwerben, als es hier in der Regel möglich ist.
Zu Kapitel 7
Die Nachtheile der Markentheilung für die Heuerleute
In diesem Kapitel beschreibt Funke die Nutzung der gemeinsamen Mark durch die Heuerleute vor der Teilung.
- Freier Vieheintrieb in die gemeinsame Weide. Sowohl Rindvieh, Schweine als auch Gänse. In Heidegegenden, wie in den Kirchspielen Berge und Bippen, auch Schafe. Durch eine relativ große Viehhaltung gewannen die Heuerleute durch die nächtliche Aufstallung viel Dünger für ihren Acker.
- Freie Plaggengewinnung für die Ackerdüngung.
- Freie Torf- und insbesondere Sandtorfgewinnung für die Feuerung. Freie Entnahme von Abfallholz ebenfalls für die Feuerung.
Nach der Teilung der Mark, die hauptsächlich in den Jahren zwischen 1820 und 1835 vorgenommen wurde[11] verloren die Heuerleute die oben aufgeführten Nutzungsrechte, da ihnen kein Rechtsanspruch auf Beteiligung zustand. Die frühere Nutzung war ihnen als Mitglieder der jeweiligen Höfe gewährt worden.
Die fehlende Nutzung der Mark machte sich bei den vorgenannten Einnahmeausfällen bei der Flachsverarbeitung und durch den geringeren Verdienst in Holland besonders schmerzlich bemerkbar.
Funke erklärte ausdrücklich, daß die Markenteilung äußerst ungerecht gegenüber den Heuerleuten war und diese nicht hätten ausgeschlossen werden dürfen. Er schreibt:
… allein die Lage der Heuerleute hat sich dadurch nicht verbessert, sondern verschlechtert. Einmal wurde dieser Boden der Gesamtheit, wozu vor der Theilung die Heuerleute mit gehörten[12], entzogen und ging in den Privatbesitz über, so daß sie weiter keinen Nutzen davon hatten; und sodann wurde dieser getheilte Boden großentheils durch ihre Kräfte urbar gemacht, ohne daß ihnen der eigentliche Vortheil zufiel. …
… Freilich wurden in den Markentheilen oft neue Häuser von den neuen Eigenthümern derselben aufgebaut und so manchen Familien eine Wohnstätte verschafft; nur müssen wir hinzusetzen, daß die Lage dieser Familien gewöhnlich eine solche war, daß sie sich wenig ihres Lebens freuen konnten. Wir glauben wenigstens dieses mit Sicherheit annehmen zu können, indem es durch diese nicht vorbereitete Vermehrung der Population dahin gekommen ist, daß unter 10 Heuerfamilien nach der Steuerrolle oft nicht mehr 1 oder 2 sich befinden, welche Personensteuer bezahlen. Die besitzlose Bevölkerung, das Proletariat unserer Fürstenthums, ist durch die Markentheilung vermehrt worden, was wir keineswegs als ein Glück für den Staat ansehen können; deren Wohlstand aber bedeutend verringert, was wir sehr beklagen müssen, und zwar um so mehr, da der Mensch, wenn ihn die schwere Noth des Lebens immer von neuem niederdrückt, wenn all sein Sinnen und Trachten nur darauf hingeht, wie er sein Leben von einem Tage zum anderen fristet, am Ende alle Empfänglichkeit für die tieferen, sittlichen und religiösen Lebensrichtungen verliert. …
In den weiteren Ausführungen dieses Kapitel geht Funke auf den sittlichen und religiösen Aspekt der Verarmung noch eingehend ein. Dies entsprach natürlich seiner Aufgabe als Seelsorger und gleichzeitig auch als Aufsichtsperson für die Schulen. Er beklagte sehr, daß die Kinder der Heuerleute vielfach zuviel mitarbeiten mußten – insbesondere als Viehhirten – und es sehr schwierig sei, sie auch nur einige Tage in der Woche zum Unterricht zu bekommen. Durch den mangelnden erzieherischen Einfluß befürchtete er eine zunehmende Verrohung und einen sittlich-religiösen Verfall bzw. eine Verwahrlosung.
Zu Kapitel 8
Die unbestimmten Dienste oder die Haushülfe
Die Preise für die Heuerstellen wurden nicht verringert, obwohl die Nutzung der Mark entfallen war. Die Hausmiete war im allgemeinen nicht sehr hoch, aber die Hilfe, die die Heuerleute leisten mußten, wurde eher noch erhöht, da durch die neuen Grundstücke aus der Mark mehr Arbeit auf den Höfen anfiel. Diese sogenannten ungemessenen Dienste waren für den Heuermann besonders drückend, d. h. in vielen Fällen war die Hilfe, die ein Heuerling leisten mußte, nicht exakt festgelegt.
Funke betonte ausdrücklich, daß die Verhältnisse auf den Höfen in bezug auf die Heuerleute sehr unterschiedlich waren. Aber neben harmonischen gab es doch wohl auch viele Fälle, in denen der Bauer zuwenig Rücksicht auf seine Heuerleute nahm. Funke schreibt dazu u.a.:
Nicht selten tritt auch der Fall ein, daß die Heuerleute plötzlich auf einzelne Stunden von dem Colonen zur Arbeit aufgerufen werden, was besonders nachtheilig ist, indem sie alsdann oft mitten in ihren Arbeiten dieselben liegen lassen müssen. Häufig wird ihnen dann nicht einmal die Kost verabreicht. Sind die Colonen billig[13], so muß das Drückende, welches in der Haushülfe liegt, in einem gewissen Grade schwinden. Ganz anders aber stellt sich das Verhältniß heraus, wenn bei ihnen die Rede: „Wenn wir pfeifen, so müssen die Heuerleute kommen,“ eine Wahrheit geworden ist; – und Beispiele, wo solches der Fall ist, sind in der That nicht selten.
Es sind uns Fälle bekannt, wo sich die Heuerleute schon zur Ruhe niedergelegt hatten, als Bestellung zu Handdiensten auf den folgenden Tag Statt fanden, und wo auf die wohlbegründete Vorstellung, daß dieses nicht wohl möglich sei, indem sie dann selber bereits angefangene Arbeiten, die durchaus beendet werden müßten, zu ihrem größten Nachtheil liegen lassen genöthigt würden, nichts anderes erfolgte, als die Antwort: Ihr sollt kommen. …
… Wir können Beispiele[14] anführen, wo sie, ohne dem Heuermanne, mag er auch noch so nahe wohnen, die geringste Nachricht zukommen zu lassen, wann die Hülfe stattfinden soll, sondern ohne weiteres, meist wenn das Wetter für die eigene Arbeit zu ungünstig erscheint, mit Pferden, Pflug und Wagen ankommen, um den Acker zu bestellen, mag der Heuermann zu hause sein oder nicht. Muß nicht solche Rücksichtslosigkeit, die ja leicht vermieden werden könnte, bei dem Heuermanne Bitterkeit erwecken?
Wir sind es jedoch der Wahrheit schuldig, hier zu bemerken, daß die Anzahl der Colonen, welche es mit ihren Heuerleuten wohl meinen, nicht gering ist, und daß in solchem Falle das Verhältniß ein durchaus billiges wird, so daß beide Theile sehr wohl mit den gegenseitigen Prästationen[15] bestehen könnten, wenn nur die übrigen Lebensbedingungen für die Heuerleute günstiger wären.
Funke brachte noch weitere Beispiele und kam endlich zu dem Schluß, daß schriftliche Kontrakte mit genau festgelegter Hilfeleistung notwendig seien. Es ist merkwürdig, daß Funke die 1845 im Kirchspiel Menslage geschlossene Vereinbarung[16] zwischen Grundbesitzern und Heuerleuten nicht anführte. Denn in dieser Vereinbarung waren gerade die von ihm beklagten Mißstände einvernehmlich – zumindest versuchsweise – beseitigt. Man kann nur annehmen, daß er diesen Text schon vorher geschrieben hatte (siehe Einleitung) und dann bei der Buchausgabe nicht daraufhin korrigierte. Eine andere Möglichkeit ist, daß die genannte Vereinbarung relativ wirkungslos geblieben war.
Deutlich schilderte Funke aber auch eine gewisse Entfremdung zwischen den Grundbesitzern und den besitzlosen Heuerleuten. Die wirtschaftliche Lage der Grundbesitzer hatte sich im Gegensatz zur Lage der Heuerleute allgemein verbessert. Funke sah etwa jetzt das Verhältnis so, wie es früher zwischen den Besitzern der Höfe und den eigenbehörigen Bauern war.
… Wie früher der Gutsherr die Eigenbehörigen im Gegensatz von sich „Leute“ nannte, ebenso redet jetzt bereits der Colonus von „Leuten“, wenn er im Gegensatz von sich die Heuerleute bezeichnen will.
Zu Kapitel 9
Die Schul- Kirchen-, Communal- und Staatslasten
der Heuerleute
In diesem Kapitel beschreibt Funke die einzelnen Abgaben, Steuern und Schulkosten der Heuerleute. Allgemein hält er diese für niedrig und wenig belastend. Er möchte die Heuerleute eher noch mehr in die gemeindlichen Abgaben und Hand- und Spanndienste eingebunden sehen. Sie sollten mehr vollwertige Glieder der Gemeinschaft sein, da:
… Politisch sind die Heuerleute durchaus unselbständig, indem sie weder als Mitglieder der Gemeinde noch des Staates auf irgend eine Weise vertreten sind[17], und doch bilden sie 2/3 der Bevölkerung unseres Fürstenthums! Ja, nur zu oft werden sie als eine so gut als gar nicht vorhandene Menschenklasse betrachtet. Auf Bauerschaftsversammlungen nicht einmal erscheinen sie mit; Verordnungen, welche dort bekannt zu machen sind und eben deshalb den Vorstehern von der Obrigkeit zugehen, gelangen deßhalb nicht zur Kunde derselben; so geschieht es denn häufig, daß sie wider Gesetze fehlen, von deren Vorhandensein sie gar keine Ahnung haben. Es wäre in der That wünschenswerth, daß es in dieser Hinsicht anders würde, und daß man namentlich bei Gemeindeangelegenheiten das Interesse der Heuerleute wenigstens nicht völlig außer Acht ließe.
Zu Kapitel 10
Der Luxus und die Vergnügungssucht
Ausführungen zu diesem Kapitel wollen wir uns ersparen, da Funke hier allzusehr – jedenfalls nach unseren heutigen Vorstellungen – ganz allgemein einen Sittenverfall sah und beklagte. Zu wenig Sparsamkeit, dazu Putzsucht und Alkoholismus sind ja Themen, die zu allen Zeiten den jüngeren Leuten oft von der älteren Generation vorgeworfen werden. Außerdem gingen seine Vorwürfe hauptsächlich an die Dienstboten und gehörten demnach eigentlich gar nicht zum Thema seines Buches. Trotzdem widmete Funke diesem Punkt fast sechs Seiten.
Zu Kapitel 11
Die Stimmung der Heuerleute
Grundsätzlich erklärte Funke in diesem Kapitel, daß die Stimmung unter den Heuerleuten sehr schlecht sei und dies auch aus den dargelegten Gründen. In den vorhergehenden Abschnitten hat er ja m.E. auch sehr sachlich und deutlich die schwierige Lage derselben geschildert. Jetzt brachte er aber einen anderen Aspekt mit hinein:
… Es läßt sich zwar nicht leugnen, daß die Noth der Heuerleute, wie wir solches glauben nachgewiesen zu haben, allerdings in den letzten Jahrzehnten groß genug geworden ist; aber wenn die Behauptung wahr ist, daß Armuth an sich weder für ein Volk noch für den Einzelnen ein Unglück ist, wenn Religiosität, Einfalt und Sittenreinheit vorhanden ist: so findet diese Behauptung auch auf die Verhältnisse der Heuerleute ihre Anwendung; denn gewiß würde die Noth derselben nicht so groß geworden sein, wenn mit einer lebendigen Religiosität die Einfalt des Gemüths und die Sittenreinheit bewahrt wäre. Weil aber bei zu Vielen der feste religiöse Grund verloren gegangen ist, so fehlt auch die rechte Ergebung und Geduld, welche im Vertrauen auf Gott ausharrt, und jene Hoffnung, welche nicht zu Schanden werden läßt.
Daß man in Zeiten der Noth sich schicken, sich einschränken und entsagen und entbehren, dabei aber mit verdoppelter Kraft arbeiten muß, davon will man nichts wissen. …
Wie oft hat Funke im vorherigen Teil eindeutig darauf hingewiesen, daß die große Not ihre Ursachen nicht bei den Heuerleuten selbst hatte. Und dann diese Gedanken, daß ihnen der rechte Glauben und die Ergebung in ihr Schicksal fehlen würden. Hiermit schob er ihnen einen Teil der Schuld selbst zu, gerade so wie heutzutage, wenn von verschiedenen Leuten z.B. den Arbeitslosen, unterschwellig auch eine Mitschuld an ihrer Lage gegeben wird. Es klingt nach Selbstgerechtigkeit und sollte wohl eine allgemeine Warnung sein, sich in ein „Gottgewolltes Schicksal“ oder in die „Gottgewollte Ordnung“ zu fügen.
Zum Schluß des Kapitels relativiert er allerdings seine anfänglichen Aussagen, indem er schrieb:
… Wir müssen bekennen, daß sehr oft die Heuerleute von vornherein in Lebensverhältnisse versetzt werden, in welchen ihnen ein sittlich-religiöses Leben, wenn auch geradezu nicht unmöglich gemacht, doch sehr erschwert wird, indem der feste gesunde Boden fehlt, auf welchem es sich entwickeln kann; die Sorge und Arbeit um das tägliche Brot reibt eine Heuerfamilie nur zu häufig, leiblich wie geistig, völlig auf. …
Funke bemerkte dann aber doch noch wieder, daß es früher besser gewesen sei – mit der Sparsamkeit und Ordnungsliebe. Die jungen Leute wären als Dienstboten durch reichliche Löhne usw. bei den Colonen verwöhnt (!), und jetzt als Heuerleute im eigenen Hauswesen könnten sie sich nicht an die frühere Sparsamkeit gewöhnen.
Es paßt in diesem Kapitel alles nicht recht zusammen – jedenfalls nicht für uns in unserer jetzigen Gedankenwelt, obwohl sich einem merkwürdige Analogien zur heutigen Zeit aufdrängen.
Wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Buches mit dem Untertitel:
Mittel zur Verbesserung der Lage der Heuerleute
Zu Kapitel 12
Die Einwirkung der Auswanderung nach Amerika
auf den Zustand der Heuerleute
Bei der zunehmenden Verarmung[18] sah es Funke als ein Glück an, daß eine bedeutende Auswanderung in die USA stattfand. Nachteilig sei jedoch der enorme Kapitalabfluß. Sinngemäß schrieb er:
Aus Menslage sind in den letzten 10 Jahren (1836 – 1846) beinahe 400 Personen fortgezogen nach den USA, welche an Kapital etwa 30.000 Taler mitgenommen haben. Das waren etwa 1/8 der Kirchspielsbevölkerung[19]. Ein weiteres angegebenes Beispiel ist Gehrde, von wo in dem genannten Zeitraum etwa 500 Personen mit über 38.000 Taler auswanderten.
Funke bedauert natürlich auch den Verlust gerade vieler junger, strebsamer Leute. Weiterhin den beginnenden geringeren Zuwachs an Kindern, da eben viele junge Familien und ledige Heiratsaspiranten den Weg in die USA nahmen. Andererseits wurden durch die Verringerung der Bevölkerung die Bedingungen für die verbleibenden Heuerleute besser. Die Colone mußten sich umstellen:
… Auch in sofern hat die Auswanderung wohltätig eingewirkt, als die Behandlung der Heuerleute von Seiten der Colonen bereits eine viel humanere geworden ist. Hat derselbe fleißige und sparsame Heuerleute, so ist er mehr als früher bestrebt, sich diese zu erhalten; auch wird bereits bei den durch mancherlei Unglücksfälle zurückgekommenen größere Nachsicht geübt.
So können wir denn nicht leugnen, daß die Auswanderung in vieler Hinsicht für die nach dem damaligen Zustande der Agricultur und bei den jetzigen ungünstigen Conjuncturen für Gewerbe und Handel übervölkerten Theile des Fürstenthums Osnabrück wohltätige Folgen gehabt hat; wenn auch oft sehr zu bedauern sein mag, daß manche, meist in der Kraft ihrer Jahre stehenden, tüchtigen Leute dem Vaterlande entzogen werden, unter dessen Schutz und Schirm sie von Jugend an nicht nur leiblich genährt, sondern auch durch Schule und Kirche für ein höheres, geistiges Leben erzogen wurden. …
Zu Kapitel 13
Die Vergrößerung der Heuern und die Verbesserung der Landwirthschaft durch Wiesencultur
Diesem Thema widmete Funke 22 Seiten seines Buches und damit fast ein Viertel des gesamten Umfangs. Neben der verbesserten Wiesenkultur behandelte er aber auch die allgemeine Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsmethoden. Die breit angelegte Behandlung dieser Fragen lassen den Schluß zu, daß Funke ein guter Kenner der Materie war und ihm diese auch sehr am Herzen lag. Ob er aus einer Bauernfamilie stammte, wissen wir nicht, aber zur damaligen Zeit war die Nähe zur Landwirtschaft allgemein doch noch sehr ausgeprägt.
Grundsätzlich wollte Funke den Heuerleuten durch eine Vergrößerung der Heuerstellen helfen. Dies war in unserer Gegend, die schon stark bevölkert war, nur durch intensivere Bodennutzung möglich. Die gewerbetreibenden Heuerleute – so bezeichnete er ja vorne im Buch diese Volksschicht wegen der Flachsverarbeitung und der Saisonarbeit in Holland – sollte eine ackerbauende werden. Er gab folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Landwirtschaft und zur Erhöhung der Produktionskraft des Bodens an:
- Schaffung von Rieselwiesen zur Erhöhung der Heuproduktion. Dies war wiederum Voraussetzung für eine vergrößerte Viehhaltung.
- Durch vergrößerte Viehhaltung mehr Dünger für das Ackerland, nach dem bekannten Motto: Das Grünland ist die Mutter des Ackerlandes.
- Beide vorgenannten Maßnahmen als Voraussetzung für die Kultivierung der mageren Heidesande in der aufgeteilten Mark. Eine Kultivierung ohne Zufuhr von Stalldünger hielt Funke damals für unmöglich und damit sinnlos.
- Sind nicht genügend Flächen für Rieselwiesen vorhanden, sollte durch vermehrten Futterbau das Verhältnis zwischen Viehhaltung und Ackerbau verbessert werden.
- Schaffung von Ackerbauschulen zur gründlichen Ausbildung der Landwirte, damit diese alle neuen Erkenntnisse, z.B. von Justus Liebig über den Nährstoffbedarf und -verbrauch der verschiedenen Nutzpflanzen, kennen lernen könnten.
Alle Maßnahmen zielten auf eine verbesserte Bodenkultur hin, damit den Heuerleuten die Möglichkeit für eine lebensfähige Landwirtschaft eröffnet würde. Diese sollten dann besonders intensiv Ackerfrüchte anbauen, die auf kleiner Fläche bei guter Pflege hohe Erträge bringen könnten. Funke sprach von der „Inneren Colonisation“, die dem Lande not täte. Er betonte immer wieder, daß eine große Viehhaltung die Voraussetzung für lebensfähige Heuerstellen sei. Unter anderem sollte dadurch auch eine bessere Ernährung gewährleistet werden:
… Bei der Vermehrung des Viehbestandes wird der Heuermann bessere und kräftigere Nahrung gewinnen, als er bisher zu genießen hatte, und zwar nicht nur insofern, als er ohne baare Auslagen gutes Fleisch für den eigenen Haushalt gewinnt, sondern auch, indem er – was wohl zu beachten ist – durch die vermehrte Michproduktion in den Stand gesetzt wird, mit seiner Familie kräftige Milchspeisen zu genießen. Der erschlaffende, leider in hiesiger Gegend nur zu viel getrunkene Kaffee und dessen Surrogate (Cichorien-, Roggen- und Gerstenkaffee etc.) würden dann selbst allmälig verdrängt werden. Es ist aber nicht wohl möglich, derartige, dem Landmanne keine Kraft gebenden Getränke zu verbannen, wenn Milch nur in geringer Quantität da ist und noch dazu Butter daraus gewonnen werden muß. …
Daß die übrigen Bedingungen für die Heuerleute ebenfalls verbessert werden sollten, war für Funke selbstverständlich. Schriftliche Heuerkontrakte, gesunde Wohnungen, keine ungemessenen Dienste, jährliche Abrechnungen usw. Diese Forderungen entsprachen eigentlich genau den Punkten der sog. „Menslager Vereinbarung zwischen Bauern und Heuerleuten, die 1845 abgeschlossen wurde. Dieses Thema griff Funke im Schlußkapitel noch wieder auf.
Ganz allgemein sollte der Heuermann mehr Selbständigkeit bekommen und dadurch zu einem anerkannten und vollwertigen Gemeindemitglied werden. Funke schlug sogar vor, daß die Heuerleute, da sie ja mehr Milchvieh halten sollten, diese zur Anspannung mit nutzen sollten. Dann brauchten sie die bisherige Pferdehilfe des Bauern auch nicht mehr zu bezahlen oder abzuarbeiten. Durch die relativ leichte Arbeit der Kühe würde der Milchertrag nur unwesentlich verringert.
Leider kann dies vorliegende Kapitel nicht umfassend erläutert werden. Es sei auf den Vorsatz zu diesem Beitrag hingewiesen. Funke gab noch eine Fülle von Informationen z.B. über die Landwirtschaft in Belgien und England, die Wirkung einer Wiesenberieselung, die hohe Bedeutung der Fruchtfolge, die Lage der Heuerleute in den Bezirken Arenberg-Meppen, Bentheim und Lingen u.v.m. Außerdem wies er oft auf betreffende Literatur hin.
Funke dachte seiner Zeit weit voraus und wollte auch durch seine Vorschläge anregen und erreichen, daß niemand aus Not seine Heimat verlassen müßte.
Zu Kapitel 14
Hebung der Industrie
Zum 1830 gegründeten Menslager Garnverein schreibt Funke in einer Fußnote:
Meistens haben sich solche Vereine, mit oft nicht unbeträchtlichen Einbußen der Theilnehmer, auflösen müssen. So auch ein Garn- und Leinenverein, welcher sich in den Jahren 1830-1831 im hiesigen Kirchspiel bildete und von der königl. Landdrostei zu Osnabrück, welche eine namhafte Summe mehrere Jahre zinsfrei herlieh, unterstützt wurde. Der Verein ließ Garn aufkaufen, gehörig sortiren und daraus breite Leinen, zunächst für Holland, weben. Der Anfang des Unternehmens war nicht ungünstig; man fand einen passenden Markt in Amsterdam und Edam. Bald indeß lief die Conjunctur ungünstig entgegen, indem die baumwollenen Zeuge den Leinenbedarf in dem Maße verringerten, daß der Verein nur zu sehr niedrigen Preisen Absatz fand. Die Folge war, daß das Geschäft ungeachtet der nicht unbedeutenden Aufopferungen, welche zunächst noch gemacht wurden, aufhören mußte.
Es ist inzwischen durch den Verein bewirkt worden, daß man anfing, bessere Garne zu spinnen und breitere und dabei schönere Leinen zu weben; denn es bewährte sich, daß die beste Waare sich am längsten auf dem Markte hielt und den meisten Vortheil brachte. Die tüchtigen und fertigen Weberinnen, welche aus dem Verein hervorgegangen sind, müssen freilich jetzt mehr oder weniger unbeschäftigt bleiben, würden aber unter günstigeren Handelsconjuncturen gewiß mit ihren starken, schönen und breiten Geweben einen vortheilhaften Markt finden.
Vor dem Hintergrung dieser Entwicklung sah Funke nur in einer wesentlichen Verbesserung des Flachsanbaus und Verarbeitung eine Möglichkeit, auch in Zukunft noch an eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit für Heuerleute zu denken. Er erklärte, daß z.B. in Belgien und besonders in Irland zwischenzeitlich eine enorme Qualitätssteigerung durch neue Verarbeitungsverfahren erfolgt sei. Außerdem sollte der Leinenverbrauch im eigenen Lande vergrößert werden.
Weiterhin wies Funke auf die schwierige Zollsituation für das Königreich Hannover hin und auf den aggressiven Außenhandel der englischen Industrie:
… Die Engländer führen einen Vernichtungskrieg gegen die deutsche Industrie, suchen sie überall aus dem Felde zu schlagen, und wie sehr dieses ihnen auf vielen Puncten gelungen ist, fühlen wir bereits auf das empfindlichste. Bei der Herrschaft, welche die englische Industrie gewonnen hat, wird indeß nicht nur der deutschen Industrie auswärts der Absatz genommen, sondern dieselbe auch im Lande selber gehemmt. …
Ohne einen Zollverein für mindestens ganz Norddeutschland, der direkten Handel mit Übersee ermöglichen sollte, sah Funke jedoch auch für eine verbesserte Flachs- bzw. Leinenproduktion wenig Chancen.
Zu Kapitel 15
Schluß
Neben den in den Kapiteln 12-14 gemachten Vorschlägen zur Verbesserung der Lage der Heuerleute, machte Funke zum Schluß noch weitere Vorschläge:
- Einrichtung von Sparkassen.
- Einrichtung von Vieh-Versicherungsvereinen
- Gründung von Sparvereinen mit Funktionen wie sie später tatsächlich in den Bezugs- und Absatzgenossenschaften verwirklicht wurden.
- Verbesserung des Armenwesens
Weiterhin stellte Funke noch Forderungen bezüglich der Heuerkontrakte auf, die jedoch schon 1845 in einer Vereinbarung zwischen den Bauern und Heuerleuten grundsätzlich festgelegt wurden. Wie schon in den Erläuterungen zu Kapitel 8 gesagt, hat Funke diese Vereinbarung offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen. Warum dies so ist, können wir leider heute nicht mehr nachvollziehen. Siehe dazu auch den Beitrag in diesem Heft: „Die Menslager Vereinbarung zwischen Colonen und Heuerleuten von 1845.“
Zum Abschluß sollen jetzt noch die Schlußworte von Pastor Funke sein seelsorgerisches Anliegen deutlich machen:
… Daher ist unser Hauptaugenmerk bei der Hervorhebung der Mittel zur Verbesserung der Lage der Heuerleute gewesen, überall darauf hinzuweisen, wie ein solcher Boden [zur Entwicklung der Arbeitskräfte der besitzlosen Bevölkerung] zu gewinnen sei. Damit ist aber noch längst nicht genug gethan; auch die Bevölkerung, welche den Boden gewinnt, muß eine gesunde sein. Diese aber ist nicht bloß durch die gegenwärtige Noth, sondern überhaupt durch die verweltlichte Richtung der Zeit nur zu häufig geistig verkümmert, ja mitunter wirklich verwahrlost. Hier muß das Christenthum mit seiner ganzen Lebensfülle als die läuternde Macht aller Zeiten eingreifen und, alles unlautere Wesen überwältigend, die Keime eines neuen wahrhaft sittlichen und religiösen Lebens wecken und zur Entwicklung bringen.
Wie dem Christenthume diese Einwirkung zu verschaffen sei, können wir hier nicht ausführen, da wir uns nur mit den äußeren Lebensverhältnissen einer wieder emporzuhelfenden Volksklasse beschäftigt und nur beiläufig deren neueres Leben berührt haben. Es ist aber die innere Belebung und Kräftigung auch der niederen, vielfältig verkommenen Volkselemente durch die evangelische Wahrheit die große Aufgabe der Zeit, ohne deren Lösung alle äußerliche Hülfe in der Noth nicht wahrhaft Heil und Segen bringen kann.
In diesen Schlußworten klingt m. E. die geistige Grundeinstellung mit pietistischen Elementen von Funke an, die dem durch Pastor Möllmann segensreich aufgeklärten Kirchspiel Menslage wahrscheinlich offenbar geworden war und nicht zeitgemäß erschien. Wie schon eingangs geschildert, wollte man Pastor Funke nicht als Seelsorger haben. Siehe hierzu die unter Fußnote 1 und 2 angegebenen Beiträge. Ob auch seine im Buch geschilderten Sorgen und Vorschläge zur Lage der Heuerleute ebenfalls zu dieser Ablehnung durch die Colone beitrugen, können wir nicht mehr nachvollziehen.
Es gab z.B. auch von der Regierung Bemühungen zur Verbesserung der Lage durch ein „Gesetz, die Verhältnisse der Heuerleute betreffend“, das 1848 herausgegeben wurde. Wahrscheinlich waren aber alle Maßnahmen nur unvollkommen, denn wie in Fußnote 18 gezeigt, hielt die Auswanderung unvermindert an. Funke schrieb dazu, daß sogar relativ gutsituierte Heuerleute auswanderten, da diese, bevor ihre kleinen Ersparnisse durch die schlechte Lage aufgezehrt seien, vorausschauend sich zur Auswanderung entschlossen hätten.
Trotz aller auch später noch vorgenommenen Verbesserungen, blieb die Lage der Heuerleute immer schwierig und das Verhältnis zwischen Bauern und Heuerleuten immer problembehaftet. Gelöst wurde das komplexe Verhältnis erst nach dem zweiten Weltkrieg durch die allmähliche Auflösung des Systems.
[1] siehe hierzu: Karl-Heinz Zissow in: „Kirchspiel Menslage, Beiträge zur Geschichte, 1990“, Kirche und Kirchspiel von der Gründung bis 1850, Seite 34/35.
[2] siehe hierzu: Lübbert zur Borg in: „Kirchspiel Menslage, Beiträge zur Geschichte, 1990“, 1845 – Es bleibt uns nur Amerika, Seite 119/125.
[3] „Colon“ war zu der Zeit die allgemeine Bezeichnung für die Hofbesitzer.
[4] Besonders interessant sind die Ausführungen über die allgemeine Lage der Landwirtschaft im Fürstentum Osnabrück, die im Kapitel 4 dargestellt sind.
[5] gemeint sind nach unserem jetzigen Sprachgebrauch „Rücklagen“.
[6] St.A. Osnabrück Rep 360 Mens. Nr. 11, Amtsbericht.
[7] Eine (hannoversche) Meile sind 9.348 Meter. Eine Quadratmeile sind demnach 87,38 km².
[8] Gemeint ist hier der landwirtschaftliche Anbau.
[9] Gemeinsam genutzte Mark.
[10] Der Menslager Garnverein von 1830 hatte hauptsächlich die Vermehrung und Verbesserung der Leinenweberei zum Ziel.
[11] Siehe hierzu auch den Beitrag „Die Markenteilung der Vierbauerschafter Mark“ in diesem Heft.
[12] An dieser Stelle ist folgende Fußnote von Funke eingefügt: In Beziehung hierauf sagt A. v. Haxthausen a.a.O. S.96: „Hut und Weide auf der ganzen Feldmark halten wir für ein Ueberbleibsel jenes uralten Gesamteigenthums, welches allen Gemeindegliedern an der ganzen Feldmark zustand, wovon sie nur stets die Nutznießung, nicht das Eigenthum besaßen.“ Bei der Theilung sind aber die Heuerleute nicht als Gemeindeglieder angesehen worden. Wir wissen freilich wohl, daß die Heuerleute auch vor der Theilung rechtlich selber keinen Antheil an der Mark hatten, sondern nur vermöge der Berechtigung ihres Grundherren; allein factisch wurden sie als berechtigt angesehen und meistentheils fand gar keine Beschränkung hinsichtlich der Benutzung Statt.
[13] Gemeint ist hier, daß der Colon auf die Arbeiten der Heuerleute Rücksicht nimmt.
[14] Dieses Beispiel gilt für die Pferdehilfe des Bauern für den Heuermann.
[15] Leistungen.
[16] Der Text dieser Vereinbarung ist weiter hinten in diesem Heft wiedergegeben.
[17] Zum Militärdienst waren die Heuerleute jedoch verpflichtet. Funke schreibt, daß fast nur Heuerleutesöhne zum Militärdienst kämen, da die Söhne der Grundbesitzer aus verschiedenen Gründen freigestellt werden könnten und sich notfalls freikauften.
[18] Funke nennt einige Beispiele: In R(enslage) sind ein Drittel der Schulkinder arm, d.h. die Eltern können kein Schulgeld zahlen. In Kl. M(immelage) und H(ahlen) ein Viertel. 1845 waren im Kirchspiel von 500 Schulkindern 133 arme.
[19] Bis 1860 waren es dann fast 1.000 Menschen, was etwa einem Drittel entspricht.