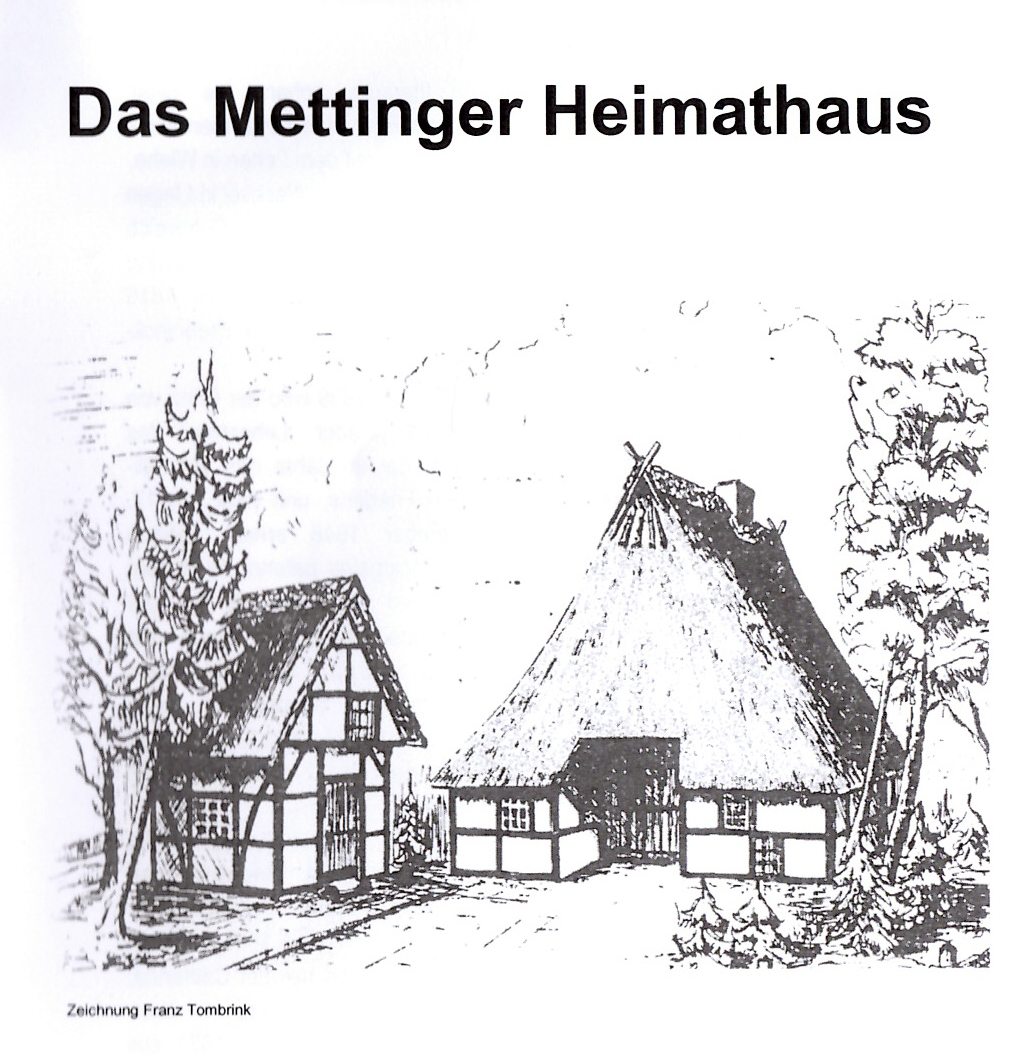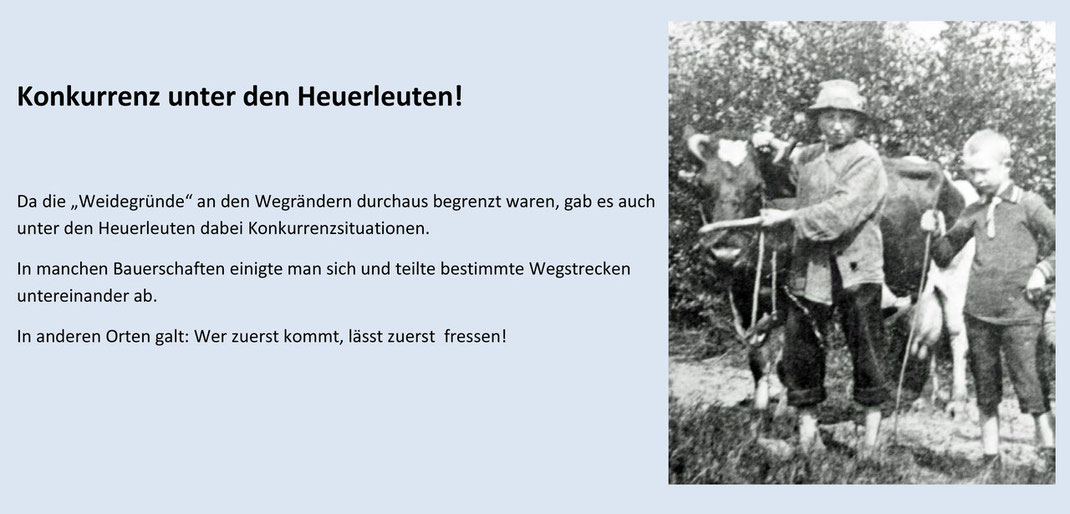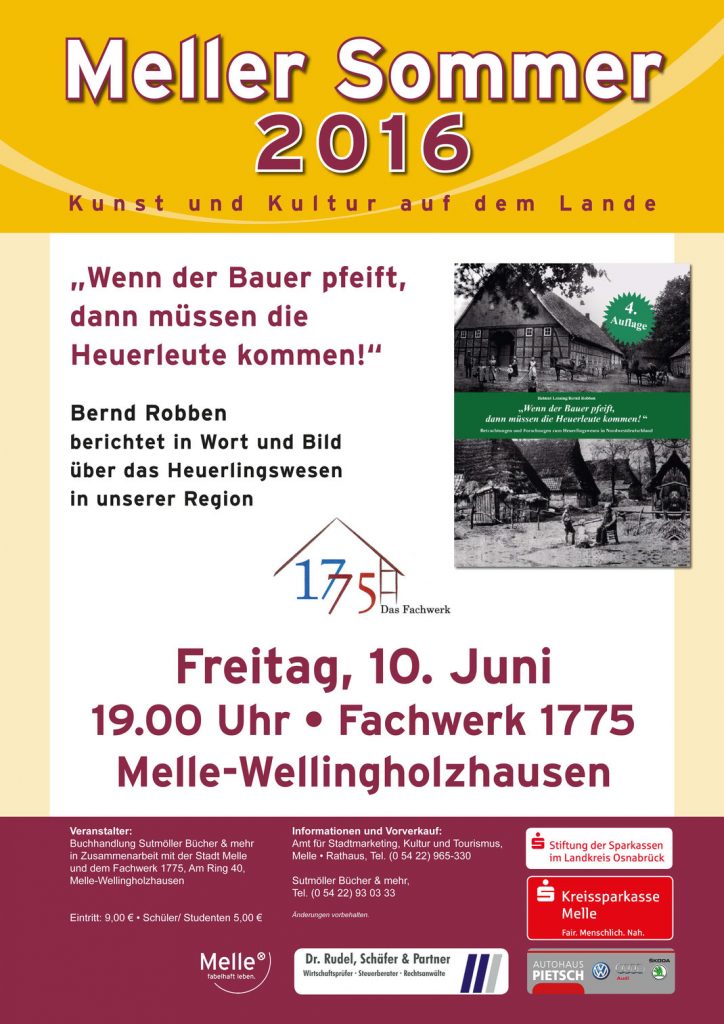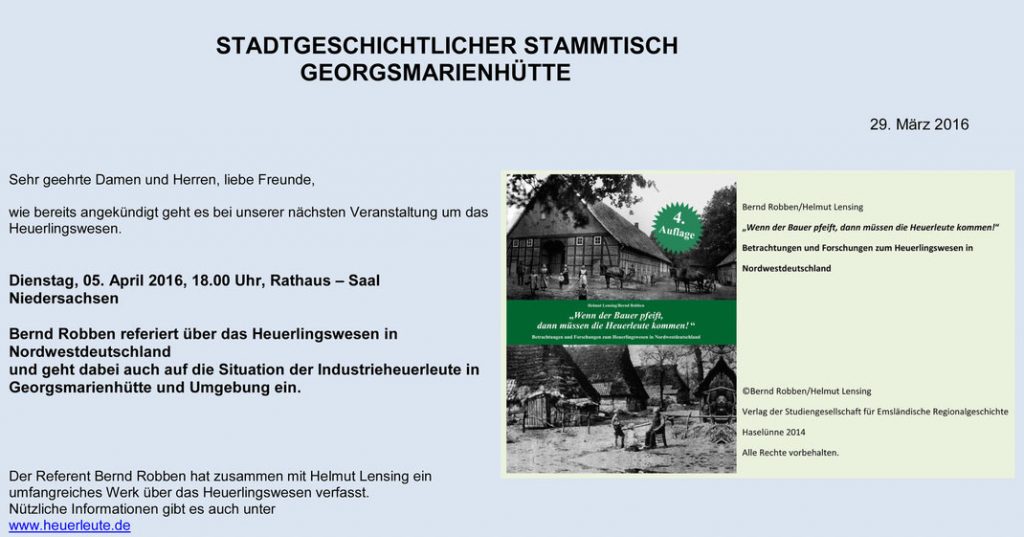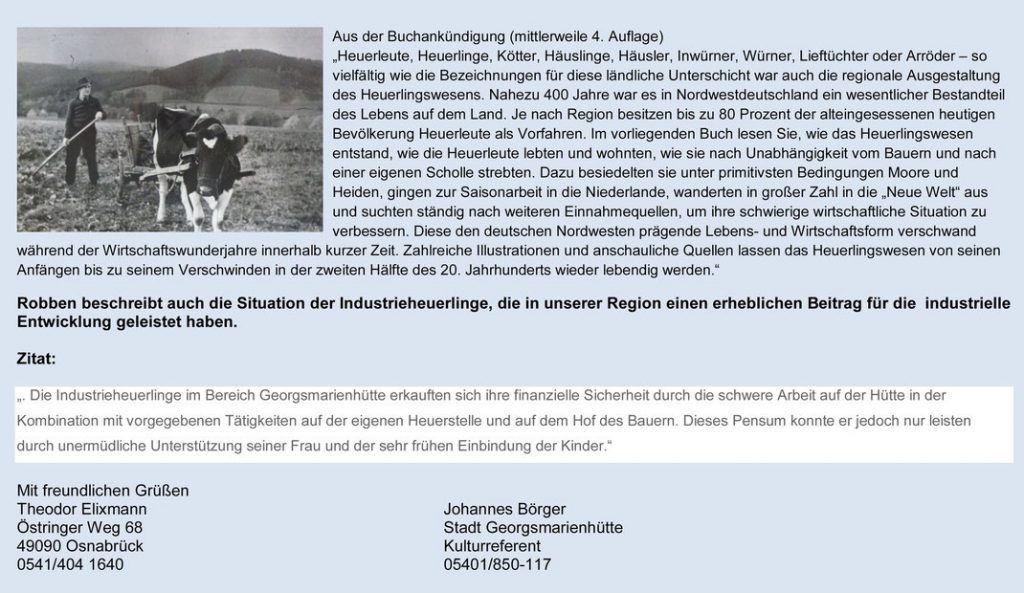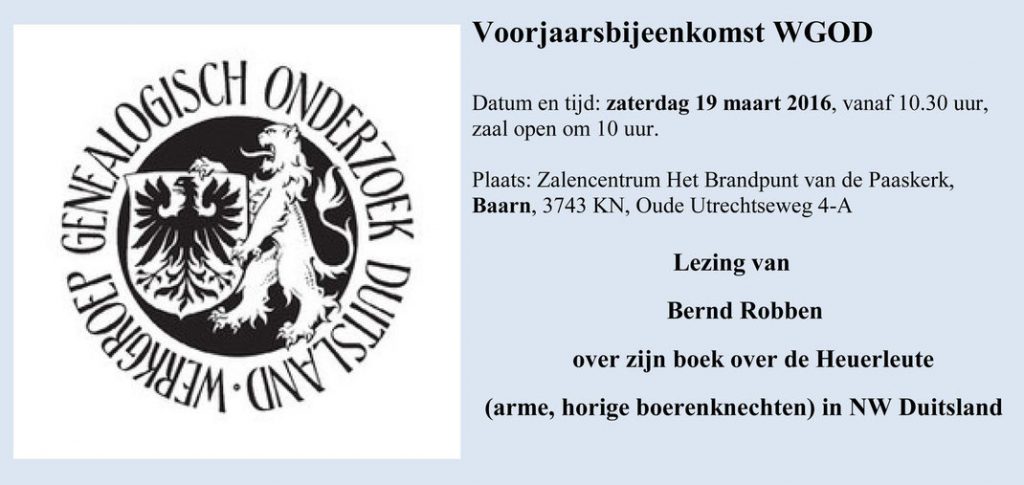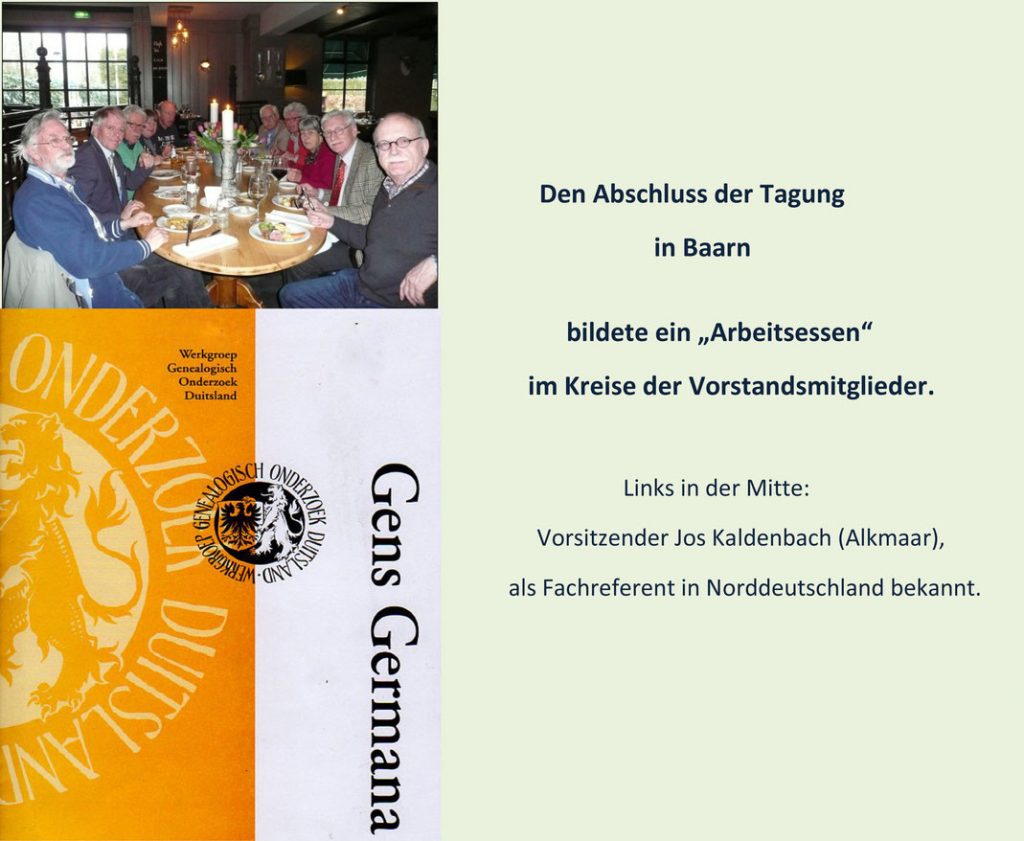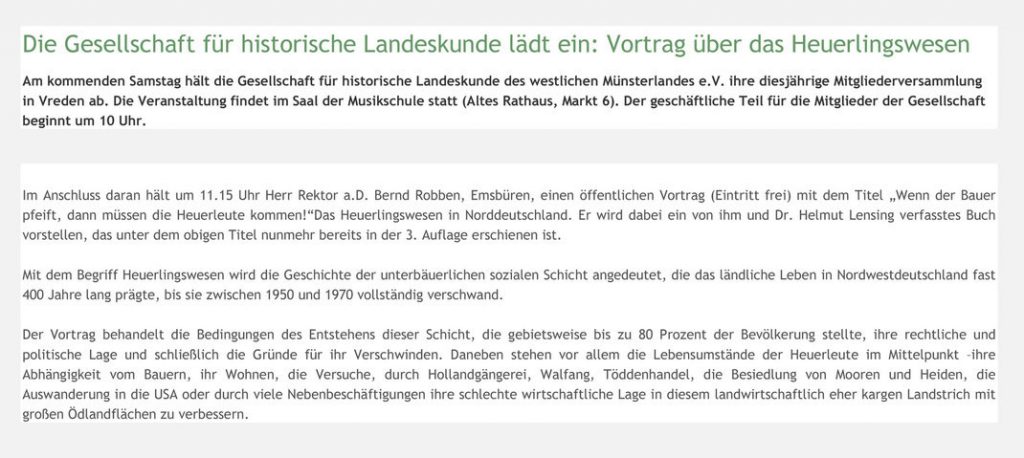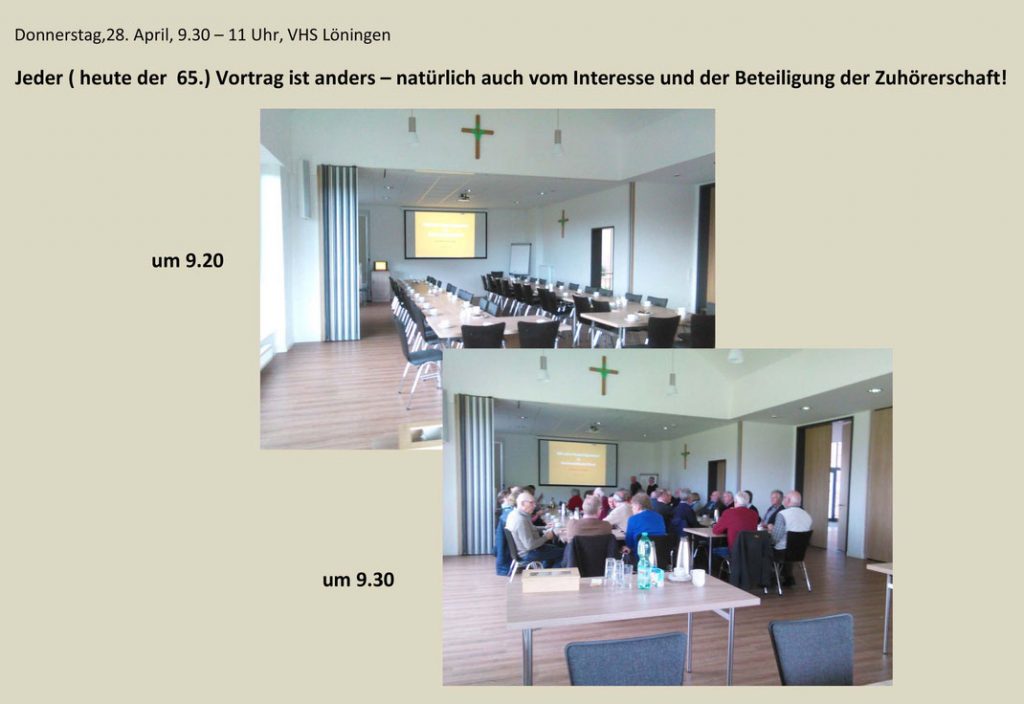DREI (verwobene) FACHWERKHÄUSER im Zentrum von Mettingen als Museum
Ein im Heuerlingsgebiet wohl einmaliges Ensemble von renovierten Fachwerkhäusern findet sich im Innenhof des Restaurants Telsemeyer. Hier sind drei ehemalige Kotten im hinteren Hof zu einem beachtenswerten Museum zur Darstellung des Töddentums in den Jahren 1964 bis 1969 entstanden.
Welchen Ursprung haben nun diese drei in ihrem musealen Charakter ineinander verwobenen Fachwerkhäuser?
- In Teilen wieder errichtet wurde ein Heuerhaus des Brenninckhofes von 1854 aus Mettingen-Wiehe, es zeigt einen tief gezogenen Walm.
- Rechts ist das Haus Herkenhoff in Mettingen-Wiehe von 1807, 1964 wieder aufgebaut.
- Das mittlere Gebäude stand früher dem historischen Gasthaus Telsemeyer gegenüber. Es ist ein ehemaliges Ackerbürgerhaus. Nach alten Plänen wurde es 1968 originalgetreu wieder errichtet.
Die drei miteinander verbundenen Fachwerkhäuser sind mit historischem Inventar und Hausrat ausgestattet und zeigen die Arbeits- und Wohnkultur eines alten Tüöttendorfes aus der Zeit vor mehr als 100 Jahren
Hier das Ackerbürgerhaus mit der ehemals großen Einfahrt…
Fotos: Archiv Robben