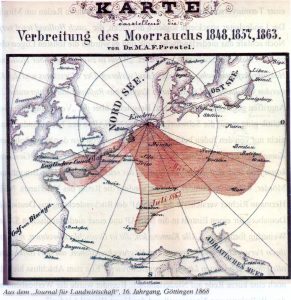Herm Bernd Gürdekamp wollte offensichtlich kein Heuermann werden.
Er zieht mit seiner Mutter 1774 in das Backhaus des Hofes,
So hatte er wenigstens ein wenig Eigenständigkeit vor der Hofherrschaft seines älteren Bruders.

Dieses Backhaus steht heute auf dem Heimathof in Emsbüren.
Freud und Leid auf dem Lande
von Anna Gerke
in: Der heimatliche Herd, Band 32, Bersenbrück 2011, Seite 400
Am 7.10.1921 wurde ich in Grönloh geboren. Meine Eltern, Dietrich Kramer und seine Frau Hermine geb. Kettler, wohnten mit den Eltern meiner Mutter, Hermann Kettler und Catherine geb. Haferkamp, in einem Mietshaus (eindeutig ein Heuerhaus s. u., Anm. des Einstellers) von Otto Brake-Middelkamp. Sie bewirtschafteten etwa 5 Hektar, sie hatten drei bis vier Milchkühe, einige Schweine und Hühner, und der Opa hatte auch Gänse. Sie hatten auch ein Pferd, das war nicht immer so bei den Heuerleuten, meistens wurde es vom Bauern ausgeliehen gegen Geld oder Hilfe.
Mein Bruder Hermann wurde am 7.2.1926 geboren, der ist leider im zweiten Weltkrieg in Russland vermisst. Wir hatten eine schöne Kindheit mit den Nachbarkindern.
Oft waren wir mit den Großeltern allein, da die Eltern beim Bauern viel Hilfe leisten mussten. Unsere Mutter musste dort auch bei der großen Wäsche helfen und beim Schlachten. Der Vater half beim Ausmisten und beim Kartoffel pflanzen. In der Heuernte, Getreideernte, Kartoffel- und Rübenernte mussten die Eltern beide helfen.
Zum Stoppelrüben ziehen musste auch immer einer helfen. Der Vater hatte noch die Gräben sauber zu machen und die Wege auszubessern, Holz fällen, sägen und spalten. Die großen Bauern hatten meistens zwei Knechte und zwei Mägde. Bei den großen Bauern wurden im Winter meistens drei Schweine und ein Bulle oder Rind geschlachtet. Das musste alles verarbeitet werden, es dauerte meist drei Tage.
Mündlicher Zeitzeugenbericht