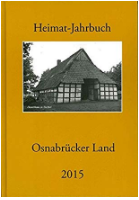Entwicklung der kleinbäuerlichen Schichten der Heuerlinge und Neubauern
von Dr. Herbert F. Bäumer
Dieser Aufsatz ist erschienen in: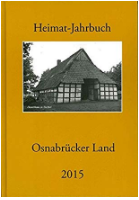
Nach Abschluss der Besiedlung durch Markkötter im ausgehenden 16. Jahrhundert entstand eine neue Gruppe der Landbevölkerung, die Heuerlinge. Zu dieser zahlenmäßig größten Bevölkerungsgruppe zählte der Heuerling mit seiner Großfamilie sowie Mägde und Knechte aus Heuerlingsfamilien auf Höfen der groß- und mittelbäuerlichen Schicht.
Grundlage der Heuerlingswirtschaft waren Kontrakte zwischen Bauern und Heuerlingen über ein bis sieben Jahre, die die Pacht einer Wohnung und eines Stückes Land beinhalteten. Für die Dauer der Pachtung war die Düngung maßgebend. Mit Stalldung betrug die Dauer drei bis vier Jahre, bei der Düngung mit Plaggen in der Regel nur ein Jahr. Heuerlinge hatten als Gegenleistung geringe Geldmiete zu zahlen und stetige Arbeitsbereitschaft vorzuhalten. Eine allgemeine zeitgenössische Formulierung besagt, dass der Heuerling und seine Ehefrau auf Wink oder Pfiff des Bauern zur Arbeit erscheinen mussten. Als Nebenerwerb boten sich Heuerlingen verschiedene Tätigkeiten wie Spinnen, Weben, als Handwerker oder Wald- und Straßenarbeiter. Im 19. Jahrhundert konnten Heuerlinge selten von Diensten beim Bauern und von Erträgen des Pachtlandes existieren, eine Entwicklung zum Wohlstand war fast unmöglich. Unvorhergesehener Unglücksfall, Krankheit in der Familie oder Verlust einer Kuh brachte dem Heuerling Verfall und Armut, oftmals mit der Folge von Moralverlust, Diebstahl oder Trunksucht. Als Gegenmaßnahme schlug Möser im 18. Jahrhundert vor, eine Ansiedlung von Heuerlingen auf eigenem Grund und Boden vorzunehmen.
Konnten Heuerleute vor Teilung der Marken deren Gründe ohne rechtliche Grundlage mitnutzen, so war dieses nach Teilung aufgrund klarer Abgrenzung gegenüber der groß- und mittelbäuerlichen Schicht nicht mehr gegeben. Die Viehhaltung für Heuerleute war stark eingeschränkt bzw. nicht mehr möglich, wodurch sich die wirtschaftliche Stellung des Heuerlings grundlegend veränderte.[1]. In den meisten Fällen stand Heuerleuten geringes Pachtland bis maximal 1,5 ha in kleinen Einheiten zur Verfügung. Der Anteil der besitzlosen kleinbäuerlichen Schicht nahm extrem zu, da sich bei hoher Kinderzahl kaum andere Arbeitsmöglichkeiten boten, als später wieder eine Heuerlingsstelle anzunehmen beziehungsweise als Magd oder Knecht auf Höfen der Groß- und Mittelbauern zu arbeiten. Andere Arbeitsplätze standen im ländlichen Raum nur im Handwerk und bedingt im Leinengewerbe zur Verfügung.
Das Verhältnis der groß- und mittelbäuerlichen Schicht zu Heuerlingsstellen lag 1806 im Allgemeinen bei circa 1 zu 3. Vorschläge der Regierung im Jahre 1816 zielten durch Regulierung der Pachtverhältnisse auf Verbesserungen. Umfangreiche Domizil- und Trauscheinordnungen von 1827 sollten die Ausdehnung der Heuerleute verhindern, ein weiterer Gesetzentwurf aus dem Jahre 1830 modifiziert die Heuerkontrakte (siehe auch Dokumentensaal). In den Folgejahren blieben Anträge der Stände seitens der Regierung ohne Bescheid. Die Landdrostei schloss sich dem Ruf nach Reformen an, stellte wichtige Punkte zusammen, um auf die schlechte Lage der Heuerlinge hinzuweisen.
„Das Sinken der Garn- und Leinenpreise; den ungünstigen Einfluß der Markenteilungen auf die Lage der Heuerlinge; den Mangel schriftlicher Heuerverträge; die ungemessene Zahl der Dienste des Heuerlings, ihre Unentgeltlichkeit und die Art der Bestellung zu diesen Diensten; den mangelhaften Zustand der Heuerwohnungen; die häufigen Prozesse zwischen Heuerling und Verpächter über die Heuer und Gegenleistungen; den geringen, zur Ernährung einer Familie nicht genügenden Umfang der Heuer; die oft schlechte Beschaffenheit der verheuerten Ländereien; die kurze Dauer der Pachtzeit.“[2]
In verschiedenen Schriftstücken an die Regierung wurde von Ämtern die Notwendigkeit bescheinigt, Heuerleute verstärkt einem landwirtschaftlichen Eigenbetrieb zuzuführen. Eine Statistik des Jahres 1847 über die Anzahl der Heuerlingsstellen im Amt Melle zeigt, dass Landbesitz der Heuerleute nicht zum Lebensunterhalt reichte und Zupachtung meist von kleinen bzw. abgelegenen Landstücken möglich war. Versorgungsprobleme bei Heuerleuten wurden in den Misserntejahren 1846/47 verstärkt, sodass die Regierung Lebensmittel verteilen musste, Branntweinbrennereien stilllegte, um Getreide zur Nahrungsmittelgrundversorgung zu verwenden. Der Anteil der Heuerlinge mit gleichzeitig geringen Pachtlandanteil war in einigen Gemeinden besonders hoch mit der Folge, dass Not und Armut in diesen Kirchspielen besonders hervortrat. Unruhen der obengenannten Notjahre wurden erst gemildert, nachdem das „Gesetz betreffend die Verhältnisse der Heuerleute“ für das Fürstentum Osnabrück vom 24. Oktober 1848 umgesetzt wurde. Danach konnten nur dann Erbpachten und Neubauereien angelegt werden, wenn die Kommissionen, bestehend zu gleichen Teilen aus Mitgliedern der Grundbesitzer und Heuerlinge, diesem Vorhaben zustimmten. Grundbesitzer mussten den Heuerlingen entgegenkommen und ihnen Pachtland zur Verfügung stellen, wenn ihnen an Heuerlingen gelegen war. Als Alternative nutzten diese sonst die Gelegenheit zur Auswanderung, um sich wirtschaftlich zu verbessern oder dem Militärdienst zu entgehen. Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Heuerleute in den Gemeinden sollte 1848 von der Regierung den Heuerleuten ein Stimmrecht in der Gemeinde eingeräumt werden. Zur Umsetzung gelangte diese Regelung erst im Zuge der Landgemeindeordnung des Jahres 1895.
Ende des 19. Jahrhunderts veränderte die industrielle Entwicklung das Arbeitsplatzangebot, sodass Heuerleute in Industriezentren zogen, ihre Heuerlingsstellen teilweise nicht mehr besetzt waren und somit durch den Grundbesitzer zum Verkauf anstanden. Im Raum Osnabrück nutzten Heuerleute Möglichkeiten zur Auswanderung beziehungsweise in Ansätzen auch Abwanderungen in nahegelegene Industriegebiete der Städte nach Melle, Bramsche, Bersenbrück, Osnabrück und teilweise auch nach Bielefeld.
Entwicklung der Neubauern als neue Form der kleinbäuerlichen Schicht
Zum Ende des 18. Jahrhunderts siedelten nachweislich erste Neubauern im Fürstentum Osnabrück. Herzog[3] nennt für sein Untersuchungsgebiet um 1806 bereits 400 Neubauern, die sich überwiegend als Handwerker in Kirchorten niedergelassen hatten. Belege für Erstnennung von Neubauern und Neusiedlern sind nicht vorhanden. Herzog rechnet auch Handwerker, die sich im Kirchdorf ein neues Haus bauten, zu dieser Klasse. In der Vogtei Riemsloh-Hoyel ist zum Beispiel von einem Schuster Johann Dirk Möller die Rede, der 1734 einen Bauplatz vom Pastorat der Kirchengemeinde Riemsloh-Hoyel kaufte und die Rechte eines Neubauern beanspruchte. Rechte und Pflichten bestanden im Beispiel des Schusters Johann Dirk Möller in einem Anerkennungsgeld von 18 Pfennig an den Erbgrundherrn und einem jährlichen Handdienst. Sein Haus wurde mit einem Reichstaler für den Rauchschatz angesetzt, außerdem stand ihm das Recht zu, von den Reihelasten befreit zu sein. 1767 wird von einem Neubauern aus Glandorf berichtet, der Markenland gekauft und diesen neuen Besitz erst 1796 zur Hälfte kultiviert hatte. In den dicht bevölkerten Kirchspielen des Amtes Grönenberg kam es zur Ansiedlung von Neubauern, die laut Herzog „nicht gut im Stande waren“. Neubauern lebten zu Beginn des 19. Jahrhundert im eigenen Haus vom Tagelohn beim Bauern oder sonstigem Nebenerwerb. Ihre teilweise geringe Anbaufläche reichte als Existenz nicht aus, folglich blieben sie abhängig und arm wie Heuerlinge. Um ca. 1800 wurden im Grönegau schon erste Klagen darüber laut, dass Neubauern, aufgrund ihrer mangelnden Kenntnisse in der Ackerbaukultivierung und wegen geringer Anbauflächen, von Erfolglosigkeit gekennzeichnet waren. Die Bewirtschaftung des geringen Eigenlandes mit eigenen Zugtieren bzw. Maschinen konnte kaum geleistet werden. Heuerlinge konnten dagegen bei Bewirtschaftung ihres Pachtlandes auf Hilfeleistung „ihres Bauern“ vertrauen, der ihnen als Gegenleistung Maschinen und Geräte überließ. Trotz widriger Umstände suchte die kleinbäuerliche Schicht weiterhin die Übernahme von Hofstellen mit Eigenland beziehungsweise mit Zupachtung. Der sich neu entwickelnde Neubauerstand rekrutierte sich in erster Linie aus Heuerlingen, Söhnen der Heuerlinge und abgehenden Söhnen der groß- beziehungsweise mittelbäuerlichen Schicht.
Kriterien für Veränderungen zum Neubauerstand
Die Entwicklung einer bäuerlichen Schicht, die, wie in früheren Epochen nach Eigenbesitz strebte, vollzog sich durch Ansiedlung der Neubauern beziehungsweise Neusiedler, die überwiegend im 19. Jahrhundert die Zahl der Gehöfte in jeder Gemeinde beziehungsweise Bauerschaft ansteigen ließen. Diese Neubesiedlung wurde vor allem aus dem Heuerlingsstand[4] durchgeführt, die sich in den Anfangsjahren, je nach Teilung der entsprechenden Marken, sehr schleppend verbreitete. Auffällig ist, dass zum Teil schon 1785 ein Teil der Marken geteilt waren. Neuansiedlungen durch selbstständige Neubauern auf eigenem Grund und Boden oder als Erbpächter auf gepachtetem Land waren mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Neubauern mussten ein Haus bauen, oft erst nur eine Plaggenhütte, beim Bauern Tagelohn leisten, durch Arbeiten wie Spinnen, Weben, Hilfsarbeiten im Forst oder Steinbruch und durch andere Tätigkeiten für den täglichen Broterwerb sorgen. Herzog [5] spricht davon, dass zwischen Heuerlingen und Neubauern im wirtschaftlichen Bereich kaum Unterschiede bestanden, teilweise war die Lage der Neusiedler noch ungünstiger. Durch Erwerb von Eigentum stieg der ehemalige Heuerling durch diese Veränderung zum Neubauern sozial auf, verbunden mit Stimmrecht in der Gemeinde.[6]
Neue Eigentümer hatten Grund- und Gebäudesteuer sowie Feuerversicherungsprämien für ihre Häuser zu zahlen und auf Instandhaltung der Gebäude zu achten. Bei Heuerlingen entfielen Steuern, Versicherungsprämien und Instandhaltungskosten für den jeweiligen Kotten. Pacht für ein Landstück war für Heuerlinge oft günstiger als Schuldzins beim Kauf der gleichen Größe Ackerland.[7] Nach volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten konnte Eigenbesitz wesentlich intensiver bewirtschaftet werden als Pachtbesitz, da unter anderem langfristige Bodenbearbeitung durch Düngung vorgenommen werden konnte.
Nach den Markenteilungen überwiegend im 19. Jahrhundert festigte sich die wirtschaftliche Lage der Großbauern, sodass nur noch vereinzelt abgelegene Flächen zum Verkauf standen. In fruchtbaren Gebieten war Bau- bzw. Siedelland nicht verfügbar. Zum Erwerb von Eigentum blieben Neubauern nur Randstücke von Wald-, Waldheide oder Moorgebieten, um so Markengrund in Kulturland umzuwandeln. Standen solche Flächen nicht zur Verfügung, blieben abgehenden Söhnen eines Hofes oder Heuerlingen nur Möglichkeiten zur Aus- beziehungsweise Abwanderung. Als Existenzsicherung versuchten junge Menschen im gewerblichen Bereich oder Arbeit in der Industrie zu finden. Um Kontinuität in der Entwicklung der kleinbäuerlichen Schicht zu sichern, förderten der Staat und die Gemeinden den Ausbau der Siedlungen, um die Einwohnerschaft auf dem Lande zu halten.[8] In der Entstehungszeit der kleinbäuerlichen Schicht war „Eigenbesitz“ für Neubauern Abgrenzungskriterium gegenüber Heuerlingen, wirtschaftliche Veränderungen jedoch waren kaum sichtbar. Die gesellschaftliche Stellung der Neubauern wurde mit dem Begriff Colon (Kolon) [9] verdeutlicht, der dadurch eine Angleichung an Erb- und Markkötter erfuhr.
| Heuerling |
Neubauer |
| besitzlose kleinbäuerliche Schicht |
besitzende kleinbäuerliche Schicht |
| Abhängigkeit vom Haupthof |
völlige Unabhängigkeit |
| vom Hof zur Verfügung gestellter Wohnraum gegen Entgelt |
eigenes Haus, anfangs Stall oder Hütte auf eigenem oder gepachtetem Land |
| Hausgröße durch Heuerlingsstelle vorgegeben |
Hausgröße bestimmt nach Finanzkraft |
| Hauserweiterung nicht möglich |
Hauserweiterung und An- oder Umbauten möglich |
| zur Hilfe auf dem Hof verpflichtet |
kann als Tagelöhner auf dem Hof mitarbeiten |
| Pachtland gegen Gebühr |
Eigenland und/oder Pachtland gegen Gebühr |
| Erweiterung durch zusätzliches Pachtland |
Erweiterung durch zusätzliches Pachtland oder durch Zukauf |
| bei Räumung bzw. Ablauf der Pacht evtl. mittellos |
bei Abgabe Erlös durch Verkaufspreis |
Unterscheidungsmerkmale von Heuerlingen und Neubauern [10]
Ausnahmen bildeten einige Neusiedler/Neubauern, die als Kaufleute oder Gewerbetreibende teilweise im dörflichen Leben hohes Ansehen erlangten und ihren landwirtschaftlichen Betrieb nur als kleinen Nebenerwerb ansahen. Heuerlinge behielten weiterhin die Bezeichnung die landläufige Bezeichnung „Kötter“.
[1] Wrasmann 1922, S. 7.
[2] Wrasmann 1922, S. 95.
[3] 1938, S. 66f.
[4] Herzog 1938, S. 132.
[5] Herzog 1934, S. 133.
[6] Bäumer 1999, S.
[7] Wrasmann 1922, S. 153.
[8] Westerfeld 1934, S. 38f.
[9] Heyse 1948, S. 160, Colonus (lat.) – Feldbauer, Ackerbauer, Acker- oder Landknechte, insbesondere Inhaber eines Colonates (Bauernstand).
[10] Bäumer 1999, S. 67 ff.
Literatur
Ahrens, H. Neubauten von Bauernhöfen der Gründerzeit und dessen näherer Umgebung, Hannover 1990.
Bäumer, Herbert F.: Neubauern als raumprägender Faktor – dargestellt an der Vogtei/Samtgemeinde Riemsloh-Hoyel – Untersuchungen zu Veränderungen einer Siedlungslandschaft im 19. Jh., Melle 1999.
Fredemann, W.: Vom Werden und Wachsen der Bauernhöfe im Grönegau, in: Grönenberger Heimathefte, Heft 2, Melle 1956.
Henning, F,-W.: Die Industrialisierung in Deutschland 1800-1914, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 2, UTB für Wissenschaft, Schöningh Verlag, Paderborn 1989.
Herzog, F.: Das Osnabrücker Land im 18. und 19.Jh., Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft zum Studium Niedersachsen e. V., Reihe A, Stalling Verlag, Oldenburg 1938.
Westerfeld, H.: Beiträge zur Geschichte und Volkskunde des Osnabrücker Landes, Haltern, Landkreis Osnabrück 1934.
Wrasmann, A.: Das Heuerlingswesen im Fürstentum Osnabrück, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde, Teil I, S. 53-171, Teil II, S. 1-154, Bd. 42 u. 44, Osnabrück 1920/22.
Bäumer,Herbert F.: Entwicklung der kleinbäuerlichen Schichten der Heuerlinge und Neubauern, in:Heimat-Jahrbuch Osnabrücker Land 2015, Seite 10 - 15