Inhaltsverzeichnis
- Hermann Bröring, Auf ein Wort
- Einleitung
- Die Entstehung und Ausgestaltung des Heuerlingswesens
Die Geburtsstunde des Heuerlingswesens
Das Verbreitungsgebiet des Heuerlingswesens
Die verschiedenen Heuerlingstypen
Der zunehmende Bevölkerungsdruck
Wohnen und Leben der Heuerlinge
- Adelige – Bauern – Heuerleute
Die Herrschaftsstrukturen auf dem Lande
Das Leben der Heuerlinge unter adeliger Herrschaft anhand von Beispielen
Die Ablösung der Bauern von der Grundherrschaft und die negativen Folgen für die Heuerleute
- Die Markenteilungen und ihre Folgen
Die allgemeine Mark oder Allmende
Übermäßiger Plaggenstich rächte sich
Die Markenteilung – Verlust einer Lebensgrundlage für viele Heuerleute
- „Ab ins Moor!“ – Neue Siedlungen entstehen
Das Moor lockt Siedlungswillige
Vom Leben der Moorkolonisten
Die Fehnsiedlungen
Die Heideflächen ziehen ebenfalls Siedler an
- Nebenverdienst durch Textilienherstellung
Flachs war lebenswichtig für viele Heuerleute
Die Herstellung des Leinens
Die Leinenherstellung beschäftigte die ganze Familie
„Osnaburgs Löwendlinnen“ für die Sklaven in Amerika
- Der Leinenherstellung folgt der Großhandel mit Textilien durch Tödden
Tödden vertreiben die Leinen
Clemens und August Brenninkmeyer – waren das Heuerleute?
Nicht nur C & A gründeten in den Niederlanden Niederlassungen
Das harte Los der Töddenfrauen
- Die Hollandgängerei
Heuerleute bildeten den größten Anteil an den Hollandgängern
Warum ging man ausgerechnet nach Holland?
Woher kamen die Hollandgänger und wohin zogen sie?
Womit beschäftigten sich die Hollandgänger?
Gefahren für die Hollandgänger
Die Heuerleute sorgten für Devisen
Die „Vereinigte Ostindische Kompanie“ – Der erste Weltkonzern als Arbeitgeber für Deutsche
Gab es eine Art Holland-Sucht unter den Heuerleuten?
Aus Heuerleuten wurden echte Holländer
- Die Lage der Heuerleute ab der Mitte des 19. Jahrhunderts
Die politische Situation
Die wirtschaftliche und juristische Lage der Heuerleute
Pastor Funke, ein Streiter für die Heuerleute
Die Menslager Vereinbarung von 1845
Einige Heuerleute erreichten eine wirtschaftliche Verbesserung
- Die Auswanderung in die Vereinigten Staaten
Schreckliche Hungerjahre
„Die Bauern fressen die Heuersleute auf!“
„Ab nach Amerika!“
Auswandern oder Dableiben?
Die Massenauswanderung nach Amerika
Es entstand eine regelrechte Auswandererinfrastruktur
Die Nordwestdeutschen in den Vereinigten Staaten
Eine Heuerlingsfamilie auf ihrem Weg in die Neue Welt
Auswandererbriefe als ideale Geschichtsquelle
- Die Heuerleute waren sehr kreativ
Heuerleute suchen Nebenerwerbsmöglichkeiten und Alternativen
Nordwestdeutschland als Hochburg von Vogelfängern
Heuerleute als Schmuggler
Die Kirche als Alternative
- Selbstversorgung – Eine wichtige Grundlage des Heuerlingwesens
Einführung
Das Brotbacken – eine wichtige Schnittstelle im Zusammenleben zwischen Heuerleuten und Bauern
Butter und Eier waren auch eine Währung
Eine illegale Form der Selbstversorgung: Das Wildern
Das Glupen war hingegen legal
Der Fischfang
- Das Verhältnis zwischen Bauern und Heuerleuten
Die Bauern saßen am längeren Hebel
Es gab deutliche Heiratsschranken
Die Stellung der Bauern auf dem Land und in der Gesellschaft
Zunächst Mägde und Knechte – dann Heuerleute
Zum Sterben konnte man nicht in ein Altersheim gehen
Das Armenwesen – auf dem Lande nur wegen der Heuerleute und Knechte
Manchmal lagen zwischen Bauer und Heuermann nur wenigen Minuten
Die Pferde: der ganze Stolz des Bauern
- Die Rolle der Heuerlingsfrau
Kaum Erwähnung in der Fachliteratur
Hürmannske – eine verächtliche Bezeichnung
Hektar zu Hektar – So wurde geheiratet
Aus dem Leben einer Heuerlingsfrau
Die Stellung der Bäuerin im Vergleich zur Heuerlingsfrau
Die Bauern und „ihre“ Mägde
Es entwickelte sich ein „Milieu des Schweigens“
- „Volksmedicin“ – auch für Heuerleute?
Gesundheit und hygienische Verhältnisse im 19. Jahrhundert
Dr. med. Jonas Goldschmidts Aufzeichnungen
Dr. med. Heinrich Book erkannte typische Heuerlingskrankheiten
- Die Einführung einer „modernen“ Landwirtschaft vergrößert die Kluft zwischen Bauern und Heuerleuten
Die künstliche Düngung wurde entdeckt
Landwirtschaftsvereine entstanden
Die Viehhaltung der Heuerleute
Der Viehbestand der Heuerleute
- Die schlimmen Verkehrsverhältnisse
Verkehrswege damals: Schlamm oder Staub
Gute Straßen brachten nur Verdruss
Der Transport mit dem Wagen oder der Kutsche – nichts für die Heuerleute!
Der Pferdeeinsatz war teuer – für die Heuerleute
Die Verkehrsanbindung war ein entscheidender Entwicklungsschritt
- Heuerleute als Schüler und Lehrer – Dumm geboren und nichts dazugelernt?
Die Unfähigkeit der Lehrer
Heuerlingskinder waren deutlich benachteiligt
Beispiele für den sozialen Aufstieg durch Bildung in ehemaligen Heuerlingsfamilien
- Die Heuerleute in der Weimarer Republik
Die Heuerleute bekamen erstmals politische Macht
Heuerleute-Versammlung in Lengerich – Nicht sozialistisch, sondern christlich!
Klassenkämpferische Töne bei den Heuerleuten im Osnabrücker Land
Weitere Heuerlingsverbände in Westfalen und im Oldenburger Münsterland
Kurzfristige Pachtkündigungen durch Bauern
„Gemeinsam sind wir stark“ – Die Heuerlingsverbände schließen sich zusammen
Die Heuerleute forcierten die Ödlandkultivierung und Siedlung
Die Heuerleute auf dem Höhepunkt ihres politischen Einflusses
- Rückschläge in der NS-Zeit
Einflussverlust mit Beginn der NS-Diktatur
Das Ende der Siedlungsträume der Heuerleute
Die Osnabrücker Gestapo berichtet über unzufriedene Heuerleute
- Das Auslaufen des Heuerlingswesens nach 1945
Völlige Fehleinschätzung 1948: 16.000 neue Heuerstellen empfohlen
Die Heuerleute kämpfen weiter für soziale Verbesserungen und Siedlungsstellen
Aus Heuerleuten werden Eigentümer
Aussiedlung und Flurbereinigung verändern die Landwirtschaft
Das Wirtschaftswunder kam – das Heuerlingswesen ging
Heuerleute als gefragte Arbeiter in der Landmaschinenproduktion
- Was ist geblieben?
III. Franz Buitmann, Kindheit und Jugendzeit in einem Heuerhaus. Harte Arbeit und Entbehrungen – aber auch wichtige Erfahrungen für das Leben
- Bernd Robben, Die Entstehung dieses Buches – ein Gemeinschaftswerk
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Archivalien
- Interviews und schriftliche Mitteilungen
- Unveröffentlichte Literatur
- Gedruckte Quellen und Nachschlagewerke
- Literatur
- Internetadressen
- Abbildungsnachweis
VII. Zeitstrahl zur Heuerlingszeit
VIII. Personen- und Ortsverzeichnis
- Personenverzeichnis
- Ortsverzeichnis
Impressum | Sitemap

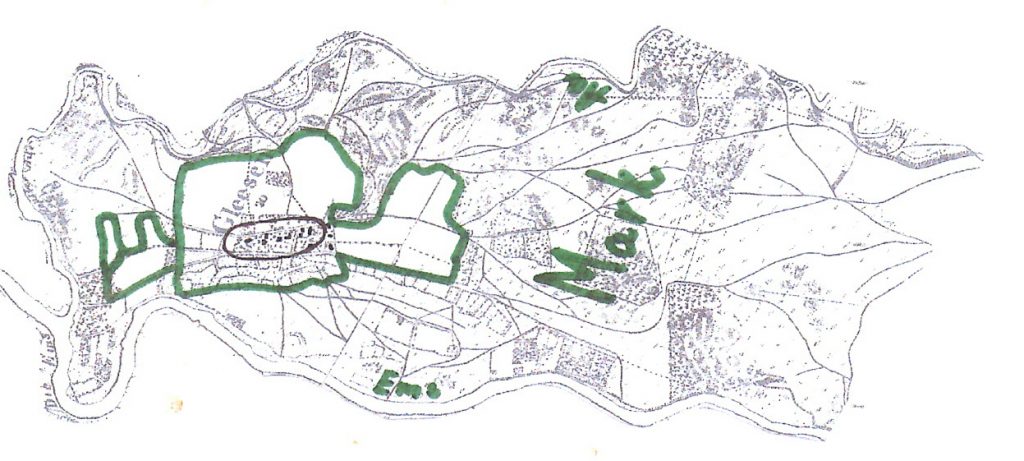
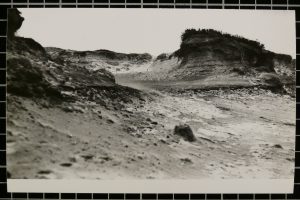

 aus dem Fotoarchiv des HV Lohne!
aus dem Fotoarchiv des HV Lohne!





