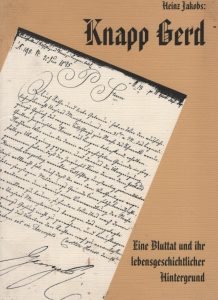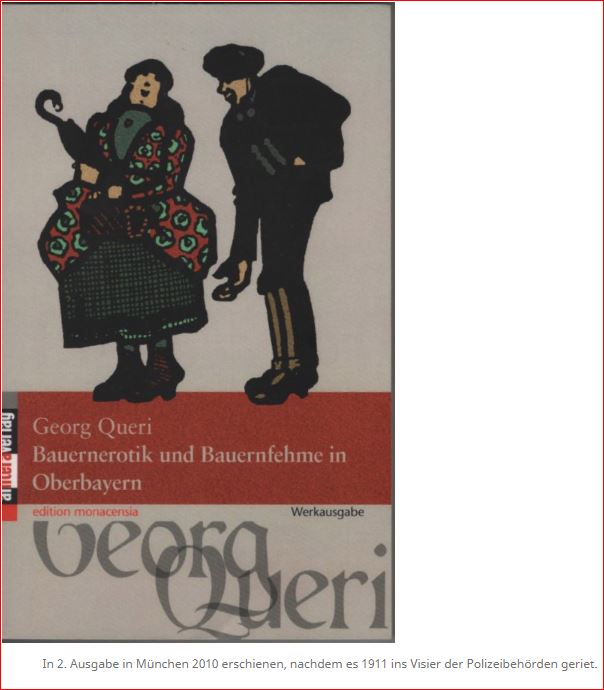aus:
Jacobs, Heinz: Eine Granne im Auge, Lingen 1995, Seite 52/53.
Wer Land besaß, galt auf dem Dorf mehr als der Landlose: der Handwerker, der Arbeiter. Wer viel Land hatte, galt mehr als der mit wenig Grundbesitz.
Die Großbauern hoben sich als besondere Klasse ab. Natürlich gab es keine durch eine bestimmte Hektarziffer genau zu bestimmende Scheidegrenze zwischen Großbauern und „gewöhnlichen “ Landwirten. Es kam ja auch auf die Qualität , nicht nur auf den Umfang der Bewirtschaftungsflächen an. Aber man kann sagen: Wer im Dorf als Großbauer galt, hatte mindestens 50 Hektar bewirtschafteter Fläche, dazu oft noch Wald oder nicht kultivierte Heideflächen. Außerdem ging er auf die Jagd – im Unterschied zum kleineren Bauern.
Es gab einen großbäuerlichen Dünkel:
Die Tochter eines Großbauern hatte Bekanntschaft geschlossen mit einem Tierarzt. Gegen eine Heirat mit ihm äußerte sie Bedenken: ,,Man häi is jä doch kien Bur“.
Ein zweitgeborener Bauernsohn von einem 20-ha-Gehöft bewarb sich um die Hand einer großbäuerlichen Hoferbin . Das Heiratsprojekt zerschlug sich. ,,De Hektars paßt nicht tosammen“, kommentierte man im Dorf .
Auf großen Höfen wuchs der älteste Sohn, der Hoferbe, im Bewußtsein der Erwähltheit auf. Wenn die Kinder eines Großbauern vor dem Gehöft an der Straße spielten , zeigten Leute, die vorüber kamen, manchmal auf einen der spielenden Jungen und sagten: ,,Dät is de Bur“.
Seit etwa 1960 kamen Entwicklungen in Gang, die das bäuerliche Selbstbewußtsein erschütterten: Die Landwirtschaft technisierte (rationalisierte) sich mehr und mehr. Der Großbauer gebot nicht mehr über Knechte und Mägde und Heuerleute, sondern hatte stattdessen Maschinen zu bedienen. Da die Preise für Agrarprodukte stagnierten und die Kosten für technische Hilfsmittel (Traktoren, Maschinen) stiegen, das Verhältnis zwischen Kapitaleinsatz und Rendite sich also zunehmend verschlechterte, geriet der Bauer bei der Technisierung seiner Landwirtschaft oft in finanzielle Bedrängnis. Andere Berufsgruppen – auch auf dem Dorf – konnten jetzt oft aufwändiger leben als der Bauer.