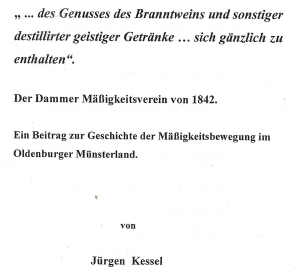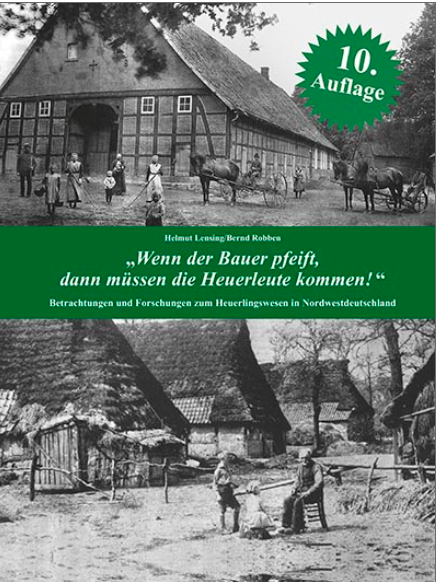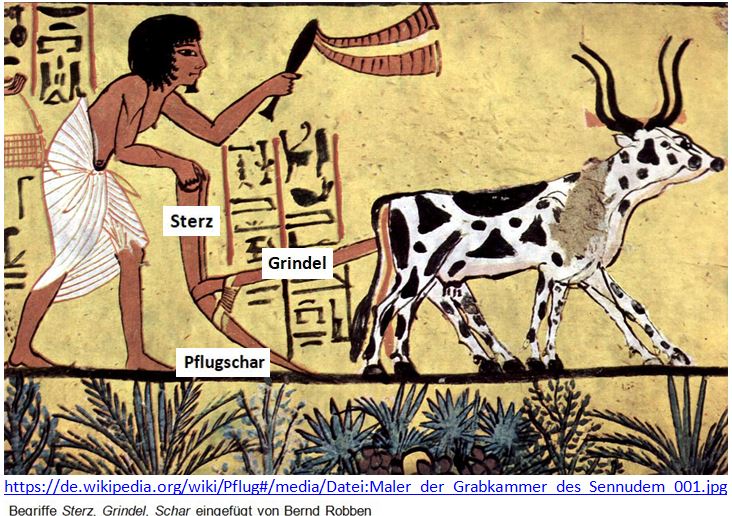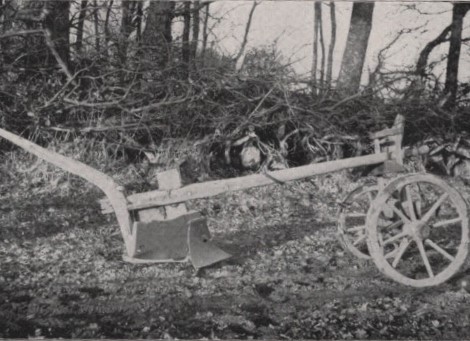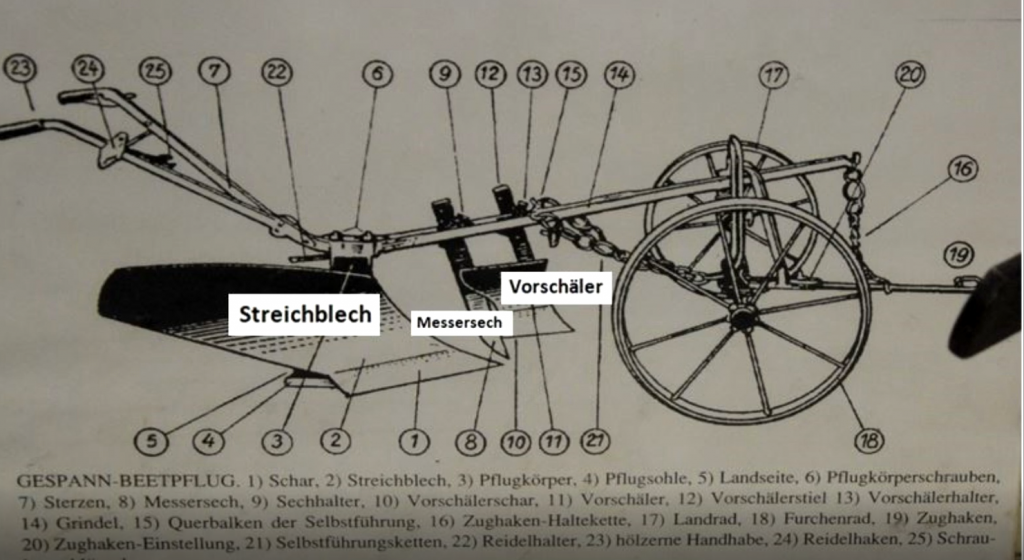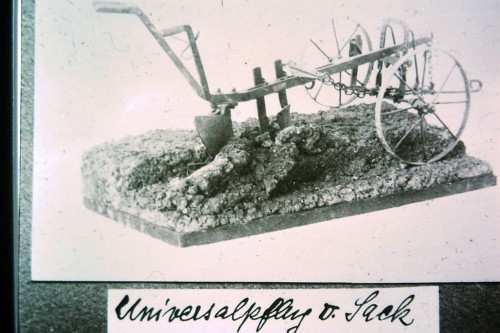Bei den VDI Nachrichten handelt es sich um eine Wochenzeitung, die über Entwicklungen in Technik und Technologie mit ihren Bedeutungen in Wirtschaft und Gesellschaft berichtet. Das Gründungsjahr ist 1921.
Wasserstoff: Pilotprojekt für grünen Stahl startet 2022 im Emsland
Der Energiekonzern RWE, das Projekt- und Planungsbüro LSF, der Stahlspezialist Benteler Steel/Tube und das Aachener Start-up CO2Grab wollen gemeinsam Technologien „zur CO2-freien Stahlproduktion“ entwickeln und testen. Heute wurde bekannt, dass das Konsortium 2022 im Rahmen eines Demonstrationsprojekts eine Wasserstoff-Direktreduktionsanlage auf dem Geländes des RWE-Gaskraftwerks im niedersächsischen Lingen bauen will.
Heute gab Niedersachsen Umwelt- und Energieminister Olaf Lies dem Aachener Start-up CO2Grab eine Förderzusage des Landes über 3 Mio. €. Das erst im letzten Jahr gegründete Unternehmen fokussiert auf die Dekarbonisierung energieintensiver Industrien wie Zement, Stahl und Chemie. Konkret werde das Geld in ein „Demonstrationsprojekt einer grünen Wasserstoff-Direktreduktionsanlage auf dem RWE-Kraftwerksgelände in Lingen“ fließen, so die Meldung von RWE.
Grüner Wasserstoff, der mit Ökostrom erzeugt worden ist, gilt inzwischen als Königsweg der Stahlbranche auf dem Weg der Dekarbonisierung. Doch wie gelingt es, mit dem Energieträger der Zukunft klimaneutralen Stahl kostengünstig zu produzieren? Diese Frage will das Konsortium aus dem Energiekonzern RWE, dem Projekt- und Planungsbüro LSF, dem Stahlspezialist Benteler Steel/Tube und dem Aachener Start-up CO2Grab unter anderem mit Hilfe des Demonstrators in Lingen beantworten.
Das, wofür man vor einigen Jahren vermutlich noch belächelt worden wäre, wird Wirklichkeit: die Defossilisierung der Stahlindustrie in Deutschland. Sie sei zentral, damit die Energiewende in Deutschland gelingt, erklärte Lies. Mit Know-how, Willen und Überzeugung bringe man die einst als „unvereinbar geltenden Ziele“ zusammen: Klimaschutz und Energiewende mit der notwendigen Zukunftsfähigkeit für unseren Industriestandort und den damit verbundenen guten Arbeitsplätzen.