Geschichte einer schweigenden Klasse: „Inwohner“ in Niederbayern
Roland Pongratz ist ein bayerisches Naturtalent in den Bereichen Volksmusik, Dialekt, Gestaltung größerer Kulturevents, Museumsleitung und mehr…
http://www.arberkultur.de/kulturbeauftragter/158/1256/
Der Landkreis Regen unterhält kein eigenes Kulturreferat o.ä., stattdessen hat er mit dem Büro für Kulturwissenschaft und -management „Kultur&Konzept“ einen Dienstleistungsvertrag geschlossen. Damit steht den Kulturschaffenden im Landkreis Regen ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung, der koordinierend und beratend tätig wird und die Kunst&Kultur-Szene des Landkreises Regen nach innen und außen vertritt.
Roland Pongratz ist nicht nur in Fachkreisen als Volksmusik-Pionier und Gründer des „Wacken der Volksmusik“ in der Kreisstadt Regen bekannt. Seit 12 Jahren wird dort alle 2 Jahre nach seiner Idee ein musikalisches Event der Sonderklasse angeboten:
Der Name Roland Pongratz und das „drumherum“ gehören zusammen, keine Frage. Dass das Volksmusik-Festival aber mittlerweile mit 400 Gruppen und 50.000 Besuchern zu den größten Veranstaltungen im Bayerischen Wald gehört, ist selbst für den Initiator eine Überraschung.
Darüber hinaus leitet er mit Erfolg das Niederbayerische Landwirtschaftsmuseum Regen.
https://www.amazon.de/gp/bestsellers/books/15779021/ref=sr_bs_0_15779021_1
Wohlgemerkt: Wir sind seit vier Jahren mit diesem Buch im Markt!
… so am 09. 01. 2019 auf Platz 1, aber panta rhei (alles fließt)!
wurde 1735 als Sohn eines Maurermeisters in Bayern geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums bildete er sich in Anschluss an das Studium der Rechtswissenschaften insbesondere im Bereich der Land- und Forstwirtschaft weiter.
Wegen seiner fortschrittlichen Ideen erwarb er sich zunehmend Anerkennung. Mehrere Veröffentlichungen bewirkten, dass er in der napoleonischen Zeit und danach auch über Bayern hinaus bekannt wurde. Seine kritischen Aufzeichnungen finden sich auch in der heutigen Fachliteratur wieder:
Trinkerei des Bauern
„Die gewöhnliche Tagesordnung eines hiesigen Bauern besteht darin, beim Erwachen in die Frühmesse und dann ins Wirtshaus zu gehen, wo Fleisch gegessen und Brandwein getrunken wird; hierauf wird bis zur Mittagszeit in den Feldern nachgesehen; nach Tisch geht er wieder ins Wirthshaus, wo er bis Abends 9 Uhr bleibt und sehr hoch manchmal um die großen Thaler spielt.
Trunkenheit ist aus dieser Ursache nicht selten, sowie auch Ausschweifungen in der Liebe …
man ist unfreundlich gegen Fremde … grüßt ihn nicht.“
Für die Masse der Kleinbauern kam aber ein solch aufwendiger Lebensstil nicht in Frage, „so daß man nicht leicht die Leerhäusler oder Tagwerker von den Kleinbauern unterscheiden kann“.
In dieser Veröffentlichung von Klaus Mohr (München 1992) findet sich obiges Zitat auf Seite 40: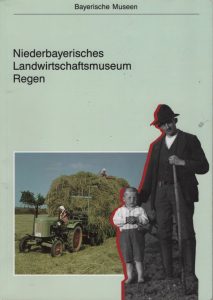
Ein Besuch beim Nebenerwerbslandwirt Franz Dufter in Burghausen im Landkreis Altötting im Jahre 2016 ergab, dass auch in den ersten drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg etliche Landwirte der Region mit größeren Anwesen diese täglichen recht intensiven Wirtshausbesuche „pflegten“.
Dieses bäuerliche Verhalten war nicht auf Bayern beschränkt.
Weitere Themenschwerpunkte dieses Fachgespräches mit Herrn Dufter:
Foto oben: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Joseph_von_Hazzi_bayJurist_19Jhd.JPG übrige Bilder:Archiv Robben
Die Arbeitszeit wird wie folgt festgesetzt: Von Morgens 6 Uhr bis Abends 8 Uhr, beim Einfahren, bis es dunkel ist; in den kürzeren Tagen von Hellwerden bis es dunkel ist. Mittagszeit wird anderthalb Stunden beim Einfahren, aber nur eine Stunde oder auch nur die zum Essen nötige Zeit gegeben (z. B. für Lader und Beistaker); auch in sonst nach Er-messen der Herrschaft oder deren Vertretung nötigen Fällen (z. 13. beim Rübenverladen u. s. w.) wird die Mittagszeit auf die zum Essen nötige Zeit beschränkt. Frühstücks- und Vesperzeit wird eine halbe Stunde, beim Einfahren zwanzig Minuten, gegeben. Vesperzeit fällt vom 24. Oktober bis I. März aus, auch darf Niemand, er sei, wo er wolle, ob in Tagelohn oder Akkord stehend, zu Frühstücks- und Vesperzeit die Arbeitsstelle ohne jedesmalige spezielle Erlaubnis verlassen, noch weniger gar zu Hause gehen.
Seite 51/52
Das bedeutet: 14 Arbeitsstunden täglich
Aus:
… können die Tagelöhner nicht genug ausgedroschen bekommen, so daß der Hofgänger über sein Vermögen hinaus arbeiten muß. Wenn der Hofgänger sagt, er könne nicht weiter arbeiten, so erhält er von dem Tagelöhner zur Antwort: „Wi wullen Di schon helpen!“ Oftmals werden die Hofgänger geschlagen. Dagegen kann er sich nicht wehren. Er ist allein und gegen ihn sind so Viele. Wenn die Hofgänger sich nicht selbst helfen, so kriegen sie nirgends Recht. Beklagen sie sich bei dem Inspektor, so meint dieser ganz einfach. „Du hast et wull verdient!“ oder „Dat is Di ganz recht!“ Überhaupt ist die Ansicht, daß der Mecklenburger sehr fleißig und der Hofgänger das Gegenteil sei, ganz falsch. Die meisten Tagelöhner arbeiten nur fleißig, wenn der Inspektor oder Besitzer hinter ihnen steht, oder wenn sie irgend eine Arbeit allein machen sollen, oder wenn es für ihren eigenen Vorteil gilt. Die Hauptsache ist dem Tagelöhner, daß er bei seinem Herrn als fleißig gilt. Der Hofgänger hingegen arbeitet gleichmäßig, gleich viel ob der Herr kommt oder ob Niemand da ist. Trotzdem werden sie als faul hingestellt. Und doch muß es sich jeder Besitzer oder Inspektor sagen, daß unmöglich den ganzen Tag so gearbeitet werden kann, wie die Tagelöhner arbeiten, wenn er dabei steht. Ist denn auch der Inspektor fort, so geht’s wieder nach dem alten Tempo und bald hat der Hofgänger die Tagelöhner wieder eingeholt. Natürlich fehlen auch von Seiten der Hofgänger die Spottreden auf die Tagelöhner nicht, zumal wenn recht viele Hofgänger da sind. Dieses ärgert den Tagelöhner ganz gewaltig, wissen sie doch, daß die Hofgänger Recht haben; das macht die Hofgänger noch verhaßter, als sie schon sind. Wenn es ohne fremde Hofgänger ginge, würde bald kein einziger in ganz Mecklenburg zu finden sein. Aber zum größten Bedauern der Gutsbesitzer geht das nun einmal nicht. Es wird zwar auf vielen Gütern versucht, die Tagelöhner anzuhalten, dass sie mecklenburgische Hofgänger einstellen. Aber da verlangen Kinder von 14 Jahren, sowie sie aus der Schule gekommen sind, solch hohen Lohn, daß die Tagelöhner lieber „Utlänner“ nehmen. 6 Taler dem Hofgänger mehr geben, ist für sie schon ein Kapital. Der Mecklenburger vermietet sich höchstens bis zu dem 17. Jahre als Hofgänger, dann verdingt er sich als Knecht bzw. als Magd. Haben sie es doch in dieser Stellung viel leichter, denn als Hofgänger und erhalten doppelt so viel Lohn. Arbeitet der fremde Hofgänger allein mit dem Tagelöhner, so hat er es immer sehr schlecht, sind aber alle Hofgänger des Gutes zusammen, so traut sich keiner von den Tagelöhnern den Hofgänger allzu sehr zu reizen.
Seite 36 und 37
August Bebel wurde 1840 als Sohn eines Unteroffiziers geboren. Schon früh verlor er seine Eltern. Er erlernte das Drechslerhandwerk.
 1869 gründete er die Sozialdemokratische Arbeiterpartei in Eisenach, wurde deren Vorsitzender und blieb bis zu seinem Lebensende im Jahre 1913 der anerkannte Führer der Sozialdemokratischen Partei. Zu diesem Büchlein schrieb er 1896 ein engagiertes Vorwort.
1869 gründete er die Sozialdemokratische Arbeiterpartei in Eisenach, wurde deren Vorsitzender und blieb bis zu seinem Lebensende im Jahre 1913 der anerkannte Führer der Sozialdemokratischen Partei. Zu diesem Büchlein schrieb er 1896 ein engagiertes Vorwort.
Die vorliegende Schrift ist einzig in ihrer Art. Ober die sozialen Zustände auf dem Lande, auch über die der Landarbeiter ist in den letzten Jahren vieles veröffentlicht worden, was das öffentliche Interesse in Anspruch nahm, aber niemals hat bisher ein Arbeiter persönlich seine Erlebnisse geschildert. Daß das bisher nicht geschah, ist nicht zu verwundern.
Der eigentliche Landarbeiter befindet sich auf dem Lande, namentlich im Nordosten Deutschlands im Zustande vollkommenster Abhängigkeit von seiner Umgebung, speziell von dem Gutsherrn bzw. dem Wächter des Guts, auf dem er arbeitet.
Seine Intelligenz ist unter dem geistigen Druck, unter dem er lebt, und bei da äußerst geringen Bildung und Erziehung, die ihm zu Teil geworden ist, eine sehr geringe und reicht in keinem Falle so weit, daß er den Mut und die Fähigkeit besitzt, sich über die ihn umgebenden Zustände zu erheben und vor aller Welt zu sagen, wie es ihm ums Herz ist. Wagte er es, er wäre ein verlorner Mann, seine Stellung wäre vernichtet und die Flucht nach der Stadt oder dem Industriebezirk wäre die einzige Rettung, die ihm bliebe.
Foto Bebel: Wikipedia Ansonsten: Archiv Robben
Der ehrenamtliche Gemeinde – Archivar von Wagenfeld, Timo Friedhof, hat eine neue Heimat – Fibel mit dem Thema Essen und Trinken. Die Ernährung auf dem Lande in alter Zeit vorgelegt.
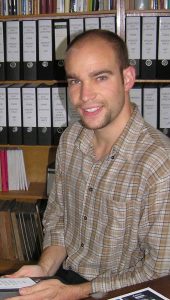 Mit dieser ansprechenden Veröffentlichung ist es ihm erneut gelungen, eine besondere Thematik der Region vorzustellen:
Mit dieser ansprechenden Veröffentlichung ist es ihm erneut gelungen, eine besondere Thematik der Region vorzustellen:
Es werden die Ernährungsgewohnheiten der ländlichen Bevölkerung vor der industriellen Revolution behandelt und 120 alte Rezepte typischer bäuerlicher Gerichte vorgestellt.
Man erfährt auch etwas über die Zubereitung der alltäglichen Speisen bis hin zu Einkoch- und Wurstrezepten früherer Zeit.
Fotos: Archiv Robben
Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete am 29. 12. 2018 auf ihrer Emslandseite:
Lingen. Das Buch „Wenn der Bauer pfeift, dann müssen die Heuerleute kommen“ ist jetzt schon wieder neu aufgelegt worden. Inzwischen zum achten Mal. Dies haben die Herausgeber mitgeteilt.
Im Herbst 2014 veröffentlichten Helmut Lensing und Bernd Robben ein Buch, das sich mit verschiedenen Facetten des Lebens der Heuerleute und der vielfach aus ihren Reihen stammenden Knechte, Mägde und Siedler im nordwestdeutschen Raum beschäftigt. Heuerleute, Kötter, Häuslinge, Inwürner, Würner, Lieftüchter oder Arröder – so vielfältig wie die Bezeichnungen für diese ländliche Unterschicht war auch die regionale Ausgestaltung des Heuerlingswesens.
Nahezu 400 Jahre war das Heuerlingssystem in Nordwestdeutschland ein wesentlicher Bestandteil des Lebens auf dem Land. Je nach Region besitzen bis zu 80 Prozent der alteingesessenen heutigen Bevölkerung Heuerleute als Vorfahren. Dennoch – während über das Leben der proletarischen Arbeiter zahlreiche Untersuchungen und Abhandlungen existieren, war das wissenschaftliche Interesse am Alltag der ländlichen besitzlosen Schicht ausgesprochen gering. Von Bernd Robben angebotene Vorträge über das Thema stießen seinerzeit durchweg auf Ablehnung bei den Verantwortlichen der ländlichen Heimatvereine.
Wegen der sehr kontroversen Beurteilung des Heuerlingswesens mit dem damit verbundenen Abhängigkeitsverhältnis der Heuerleute von den Bauern war dies ein Tabuthema auf dem Land,
Die Erfahrungen und Überlieferungen beider Gruppen zum Heuerlingssystem unterschieden sich komplett. Völlig überraschend avancierte daher ihr Buch zu einem regionalen Bestseller. Es traf einen Nerv der ländlichen Bevölkerung und führte zu zahlreichen Anfragen nach Vorträgen.
Verbitterung
So hielt vor allem der Pensionär Robben inzwischen weit über einhundert Vorträge im gesamten Verbreitungsgebiet des Heuerlingswesens und erlebte in den Diskussionen die immer noch teilweise tief sitzende Verbitterung ehemaliger Heuerleute. Nach einiger Zeit ging er dazu über, die Aussagen von Zeitzeugen mit der Kamera festzuhalten, um sie für die Nachwelt zu sichern. Darüber ist auch auf seiner Internetplattform „heuerleute.de“ nachzulesen.
Mitte November 2018 erschien die von Helmut Lensing leicht überarbeitete 7. Auflage. Doch auch sie war bereits nach gut drei Wochen vergriffen. Viele Buchanfragen konnten nicht mehr bedient werden. Ein Teil der umgehend in Auftrag gegebenen wortgleichen 8. Auflage wurde immerhin schon zum vierten Adventswochenende ausgeliefert. Damit erreicht das Werk inzwischen eine Auflage von nahezu 15 000 Exemplaren und ist eines der auflagenstärksten regionalgeschichtlichen Veröffentlichungen im Nordwesten seit Jahrzehnten geworden.
Nun ist die 8. Auflage des Buches wieder über den Buchhandel (ISBN 978-3-9818393-1-9) zum Preis von 24,90 Euro erhältlich oder kann unter kontakt@emslandgeschichte.de (zzgl. Versandkosten) direkt bestellt werden
Kleine Inhäusl mit wenig Wohnraum für viele Menschen
aus: Dr. Helmut Bitsch: Inwohner – ein verdrängtes Kapitel bayerischer Agrargeschichte
in: Hermann Heidrich (Hg.): Mägde Knechte Landarbeiter
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft in Süddeutschland, Bad Winsheim 1997, Seite 55
Die Größe der Inhäusl entsprach durchwegs der von Austragshäusern, nur daß in ersteren eine ganze, meist kinderreiche Familie Platz finden mußte. Die winzigen Einfirstanlagen verfügten über selten mehr als Stube, Kammer, Dachboden, Stall für ein bis zwei Kühe und manchmal einen kleinen Scheunenteil. Nicht nur in der Bavaria werden die Inhäuser als „gewöhnlich im schlimmsten baulichen Zustande“ geschildert. Für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts berichten Gewährspersonen von schadhaften Dächern, Fenstern und Öfen sowie von häufig feuchten und schimmeligen Räumen. Der schlechte Bauzustand wirkte sich umso gravierender aus, als die Inwohner unter ständigem Brennholzmangel litten. Der Zustand der Inhäuser oder für Bauerhalt schien für die Bauern von keinerlei Interesse gewesen zu sein. Wurden es völlig unbewohnbar, hat man sie abgerissen und gegebenenfalls durch neue ersetzt. Nur wenn eine Hofübergabe ins Haus stand, wurde das Inhaus für die Austrägler renoviert oder durch einen Neubau ersetzt.
Der Wohnraum der Inwohnerfamilien war auf das äußerste beschränkt, speziell die Multifunktionalität der Stube gegenüber bäuerlichen Anwesen wesentlich erhöht. „Bei ärmeren Leuten wird oft ein Stück Kleinvieh, ein Schweinchen o.dgl., im strengen Winter auch noch Hühnervolk in solch einer Stube untergebracht, wo es von Kindern nur zu oft wimmelt, die aus den feuchten, kalten Kammern ihr Lager dann auf die Ofenbänke oder die Bank daneben verlegen. In solchen Gemächern ist dann wenig Ordnung und Reinlichkeit zu erwarten und man kann unter den Inhäusln und die Hütten der ärmeren Innerwäldler menschliche Wohnungen finden, die kaum für solche angesehen werden können.“
Die Stube war gleichzeitig Küche und Arbeitsraum für den Zuerwerb, ohne den die Familie nicht hätte existieren können.
Fotos: Archiv Niederbayerisches Landwirtschaftsmuseum Regen