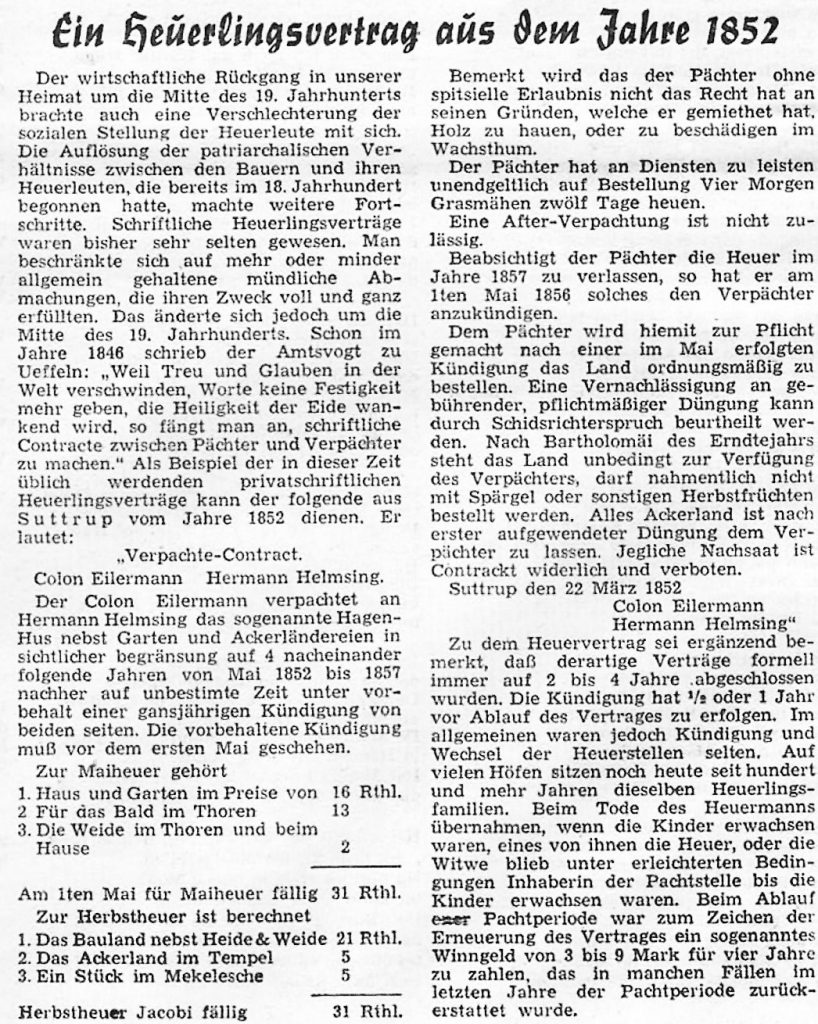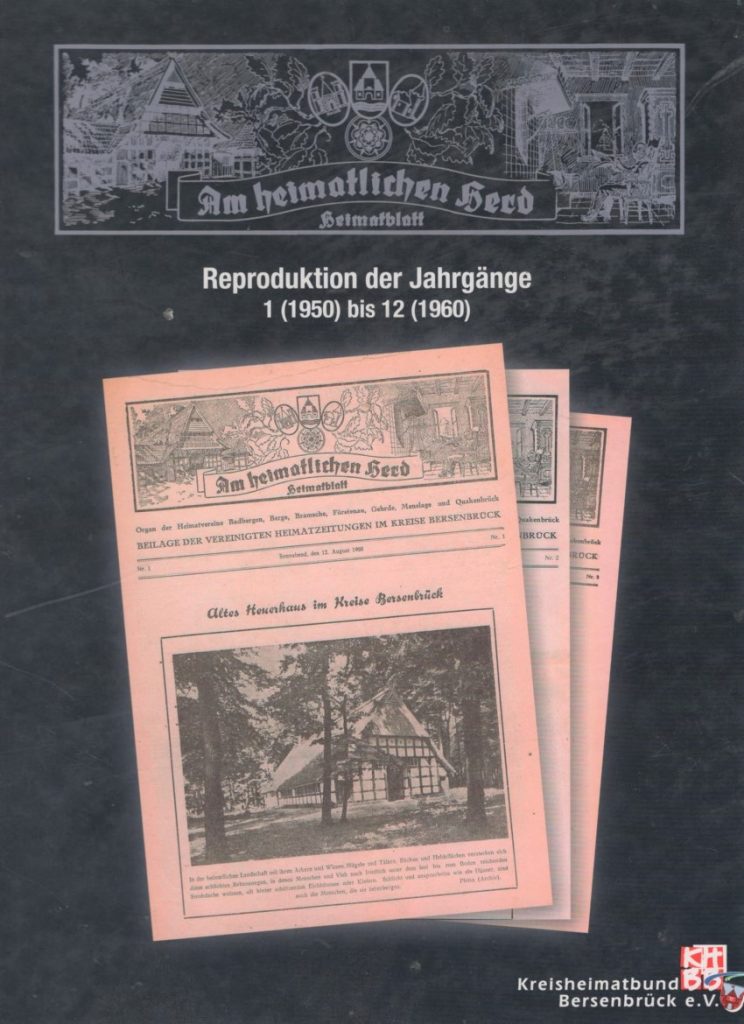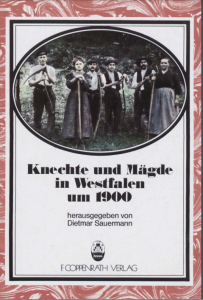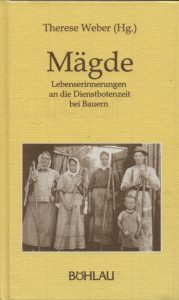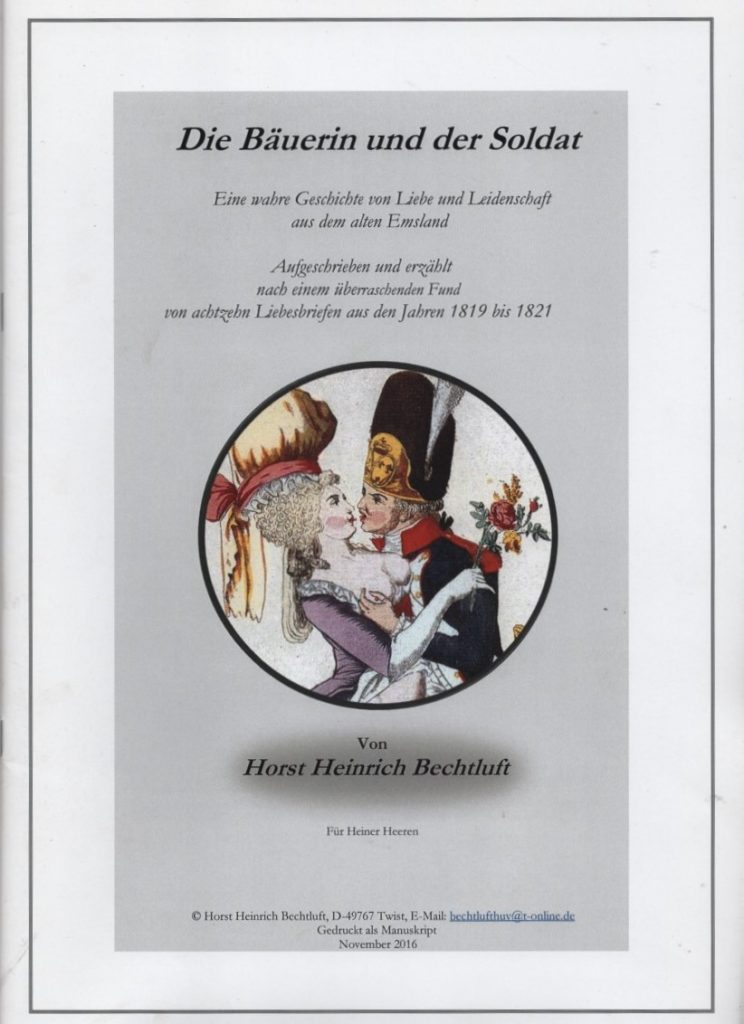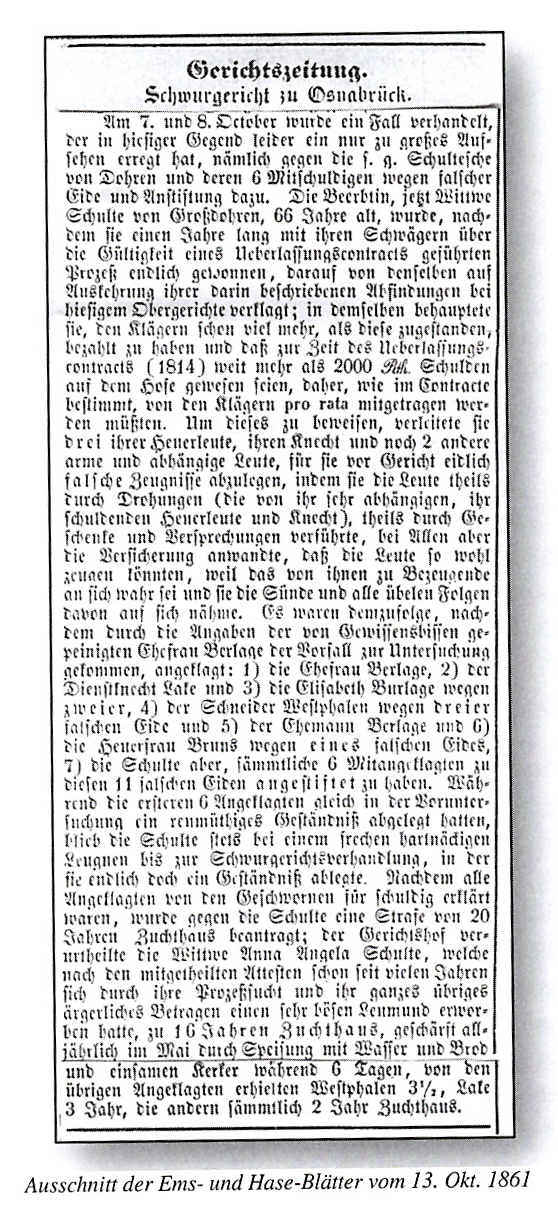Wrasmann, Adolf: Das Heuerlingswesen im Fürstentum Osnabrück, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück, Teil I Bd. 42/1919, Osnabrück 1920, S. 52
Die Heuerleute wurden ferner zu den Wolfsjagden mit herangezogen. Wölfe kamen besonders in den ausgedehnten Waldungen des dünn bevölkerten Nordens vor. Durch die Wirren des 30jährigen Krieges wurde ihre Vermehrung begünstigt. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren sie nicht ausgerottet, denn noch im Jahre 1786 wurden Prämien für ihre Erlegung ausgesetzt. Die Bauern führten daher auf ihren sonntäglichen Gängen zur Kirche so genannte Wolfsspieße mit sich, von denen sich jetzt noch manche auf den Bauernhöfen befinden sollen. Richteten die Wölfe allzu großen Schaden an, so wurden die Amtseingesessenen zu einer Jagd auf sie aufgeboten. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts scheint man zum ersten Mal auch die Heuerleute dazu aufgeboten zu haben. Denn im Jahre 1654 beschwerten sich das Domkapitel und die städtische Kurie über ihre Heranziehung, dass sie wider das alte Herkommen sei. Im Jahre 1658 drangen die Stände auf`s neue auf Befreiung der Leibzüchter und Heuerlinge. Der Fürst entschied jedoch, dass nur die alten und bresthaften Leibzüchter, nicht aber die jungen und die Heuerleute befreit sein sollten.
- Aus dieser Dienstpflicht entwickelte sich im Kirchspiel Gehrde eine nur von den Heuerleuten erhobene Abgabe, der so genannte Wolfshafer, der bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts an den Vogt zu liefern war. Der Vogt, als Anführer bei den Jagden, sollte den Hafer zur Haltung eines Dienstpferdes verwenden. Ursprünglich soll eine Gepse Hafer (soviel wie zwischen beiden Händen gehalten werden kann), später eine hochaufstehende Mütze voll und dann ein halbes Seifenfass voll Hafer gefordert sein. Schließlich belief sich das Maß auf einen halben und dann auf einen ganzen Scheffel. Nach dem Aufhören der Wolfsjagden hatte diese Abgabe ihre Berechtigung verloren; sie wurde aber weiter erhoben. Im Jahre 1720 führten die Bauern über die Einziehung des Hafers Beschwerde, da sie befürchteten, es könne daraus eine Belastung ihrer Höfe entstehen. Der Vogt wurde darauf von dem Rentmeister in Vörden amtlich vernommen. Es gab an, das seit den Zeiten Franz Wilhelms seine Vorgänger und er stets den Hafer erhoben hätten. Der jährliche Ertrag der Abgabe belaufe sich auf 6 Malter. Auch die Bauerrichter wurden amtlich vernommen. Aus diesen Verhandlungen ergab sich, dass ursprünglich die Abgaben freiwillig gegen Erlassung des Dienstes geleistet wurden, dass hieraus dann ein Recht hergeleitet wurde. Anfangs wurde nur von einigen Heuerleuten Hafer gegeben, allmählich aber von allen die Abgabe gefordert. Über einen Bescheid an die Bauern ergeben die Akten nichts. Er muss aber ablehnend ausgefallen sein, denn erst im Jahre 1848 wurde diese Abgabe der Gehrder Heuerleute aufgehoben.